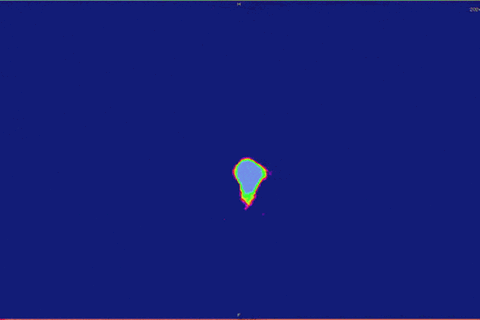Am 4. Juni, 12.10 Uhr, steigt Klaus Seidel mit seinem Neffen Fritz im Schweizer Flüelen in den Zug. Die Reise geht nach Basel, knappe zwei Stunden Fahrt. Dann über die deutsche Grenze. Sie haben einen Koffer und einen Rucksack dabei. Sie sind nervös. Wenn der alte Mann an diese Reise zurückdenkt, dann flüstert er mit verschwörerischem Blick: "Wir sind klammheimlich abgehauen." Es war die Flucht eines 88 Jahre alten, gesundheitlich angeschlagenen deutschen Staatsbürgers aus der Schweiz. Klaus Seidel hatte nur diese Wahl, fanden er und seine Verwandten: entweder in einem Heim völlig zu verblöden. Oder: Flucht. Sie organisierten die Flucht.
Die Probleme mit Klaus Seidel waren aus ziemlich heiterem Himmel gekommen. Der pensionierte Justizbeamte war lange ausgesprochen fit gewesen. Er hatte früher viel Fußball gespielt, im fortgeschrittenen Alter ging er jeden Tag spazieren, immer um die sechs Kilometer bergauf und bergab. Seit 1986 lebte er in einem großen Haus in Altdorf im Kanton Uri, er pflegte seine gebrechliche Frau, eine Schweizerin, hielt den Garten in penibler Ordnung, kümmerte sich mit Hingabe um die Rosen und um seine Mercedes-Limousine. Oft saß er bei seinem Nachbarn Gerry auf der Terrasse und trank mit ihm ein, zwei Bier.
Weihnachten 2014 fiel Gerry auf, dass etwas nicht mehr so ganz stimmte. Klaus Seidel fabulierte am Telefon merkwürdige Sachen mit sehr langen Pausen. Der Nachbar verständigte den Rettungsdienst. Seidel kam ins Spital. Ein Schlaganfall. Er war schwach und verwirrt.
Sein Bruder Helmut und Fritz, der Neffe, reisten aus Deutschland an. Schon im Spital wurden sie unter der Hand vor der KESB gewarnt, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die rigoros die Fürsorge für Menschen übernehme, die als nicht mehr ganz zurechnungsfähig gelten. Die KESB hat in der Schweiz viele Gegner, unter ihnen auch die Schriftstellerin Zoë Jenny. Die schrieb im "SonntagsBlick": "Diese Behörde ist nicht nur inkompetent und technokratisch, sondern vollkommen intransparent. Man bekommt keine vernünftige Auskunft, es ist, als wäre man in China."
Die Seidels kümmerten sich nicht darum. Sie hielten die Schweiz für ein humanes Land, kannten bis dahin vor allem, was ihr Bruder Klaus ihnen stolz gezeigt hatte: die prächtigen Alpen, die gute Schokolade und das Denkmal des unerschrockenen Wilhelm Tell mitten im Ort.
Die fünf Brüder und Schwestern von Klaus Seidel, die in Deutschland leben, entwarfen einen Plan: Ihr Bruder sollte nach Krankenhaus und Kur zusammen mit seiner Frau in ein zentral gelegenes, offenes Altenheim ziehen. Sie mieteten ein großes Zimmer mit zwei Betten, richteten alles hübsch her, Klaus Seidels Frau fühlte sich schnell wohl dort.
Der alte Mann wurde in die Psychiatrie gebracht
Doch Klaus Seidel wollte nicht mit einziehen. Er wollte, als man ihm nach der Reha sein neues Zuhause zeigte, zurück in sein Haus. Er wurde laut und sehr aufgeregt. Je mehr ihm die Heimleiterin und sein Bruder hineinredeten, desto wütender wurde er. Schließlich schrie er: "Dann erschieße ich mich lieber gleich. Mich und meine Frau auch.“ Die Geschwister wussten, dass er das nur aus Verzweiflung gerufen hatte. Er konnte gar nicht schießen, er hatte auch keine Pistole. Doch die Schweizer nahmen es wörtlich.
Von diesem Moment an stand die Frage im Raum: Wem gehört Klaus Seidel? Wer darf über sein Schicksal verfügen? Geklärt ist sie bis heute nicht.
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde schaltete sich ein. Der alte Mann wurde, flankiert von zwei Polizisten, nach seinem Wutausbruch in die Psychiatrie gefahren. Die Diagnose: Er sei urteilsunfähig und gefährlich für sich und andere. Außerdem könne er sich selbst nicht mehr versorgen und sei mittel bis schwer dement. Ein Kantonsarzt bestätigte später diese Diagnose. Jetzt übernahm die KESB das Kommando.
Die Kommunikation über die Zukunft von Klaus Seidel spielte sich nun vorwiegend zwischen der Behörde und der Psychiatrie ab; in weitem Bogen über die Köpfe der Verwandten hinweg. Liest man die Briefwechsel, drängt sich der Verdacht auf: Die Angehörigen waren vor allem lästig. Deren Vorschlag, einen privaten Pflegedienst bei Klaus Seidel zu Hause zu organisieren, an dem sie sich intensiv beteiligen würden, wurde nicht weiter beachtet. Die Behörde brachte ihn stattdessen im März in ein Heim für schwer Demente: eine ehemalige Kabelfabrik, vor den Fenstern Gitter, draußen eine umzäunte Terrasse, alte Menschen in den Räumen, die verstummt sind oder lallen, von denen viele mit weit geöffnetem Mund den ganzen Tag sitzen und vor sich hin starren. Überall Rollatoren und Rollstühle, im Hintergrund läuft Volksmusik. Kosten: 5000 Franken im Monat, umgerechnet 4800 Euro.
Als Fritz Seidel, besondere Kennzeichen: feuerrot gefärbtes Haar und Augenbrauenpiercing, seinen Onkel im Mai dort besuchte, erlebte er einen zutiefst unglücklichen Mann. Fritz Seidel hatte den Eindruck, dass alles, was der Onkel tat, als Bestätigung dafür interpretiert wurde, dass er in genau so ein Heim gehörte.
"Ich habe doch nichts getan"
Weil er auf der kleinen Terrasse verzweifelt auf und ab lief, hieß es, er renne planlos herum. Und als er bei leichtem Regen nach draußen wollte, um einen Regenbogen anzuschauen, sei das von einer Pflegerin als "ganz schön verrückt" bezeichnet worden. Wenn Fritz Seidel mit seinem Onkel spazieren ging, hatte er einen ganz anderen Eindruck: Der Mann war zwar verlangsamt. Aber er fand die Wege, was er sagte, hatte Hand und Fuß, er sorgte sich um seine Frau. Und er weinte viel und empörte sich: "Ich habe doch nichts getan. Man darf mich doch nicht einfach einsperren!“
Die Familie in Deutschland legte gegen die Einweisung ins Heim Beschwerde beim Obergericht Uri ein, der Behörde, die im Bedarfsfall das Vorgehen der KESB überprüft. Die Angehörigen erfuhren, dass es Wochen bis zu einer Entscheidung dauern könne – und außerdem, dass sich dieses Gericht oft mit den Angaben der KESB zufriedengebe und die Gegenseite gar nicht hören würde. Vor wenigen Tagen, am 10. Juli, hat das Obergericht die Klage tatsächlich zurückgewiesen. Ginge es nach den Richtern, säße Klaus Seidel wohl bis an sein Lebensende in der alten Kabelfabrik. Der alte Herr und seine Familie sahen die Gefahr – und entschlossen sich zum Handeln.
Ein großes Familienfest gab den Ausschlag, die Entscheidung des Obergerichtes gar nicht mehr abzuwarten. Für den 6. Juni hatte ein Schwager zu seinem 80. Geburtstag nach Remscheid eingeladen, Klaus Seidel freute sich darauf, an die 100 Verwandte und Bekannte wiederzusehen. Die KESB verbot ihm aber die Ausreise, eine Vertreterin teilte dem konsternierten Bruder Helmut Seidel mit, das würde zu viel Durcheinander bedeuten. Die Leiterin der Pflegeeinrichtung machte daraufhin einen Vorschlag zur Güte: Man könne das Fest doch in die Schweiz verlegen.
Zu viel kam in diesem Moment für Klaus Seidels Verwandte zusammen. Auch die schmerzliche Erinnerung an gescheiterte Besuchsanträge aus DDR-Zeiten war plötzlich wieder da. Ein Teil der Seidel-Geschwister hatte in der DDR gelebt, der andere Teil in der BRD. Als der älteste Bruder im Westen im Sterben lag, durften die aus dem Osten ihn nicht besuchen. Die Ausreise wurde erst zur Beerdigung gestattet. So etwas würden sie sich nicht noch einmal gefallen lassen.
Der alte Mann wird gefeiert wie ein Heimkehrer
Klaus Seidel ist genau informiert am 4. Juni. Er findet den Fluchtplan gut. Er verabschiedet sich bei einem Besuch mit seinem Neffen unauffällig von seiner Frau, die seit Februar und bis heute im Altenheim in Altdorf lebt. Um 17.25 Uhr, als sie über die Grenze sind, ruft Fritz, der Neffe, die Leiterin der Dementeneinrichtung an und sagt, sie seien „drüben“. Die Frau ist empört. Als die beiden zwei Tage später beim Familienfest erscheinen, wird der alte Mann gefeiert wie ein Heimkehrer aus Sibirien. Er lacht so viel wie schon lange nicht mehr.
Nach dem Fest wird er ins Erzgebirge gebracht, er zieht dort in ein großes Haus zu seinem 74-jährigen Bruder und dessen Frau, seiner Nichte und deren Mann. Im ersten Stock ist für ihn ein kleines Zimmer mit Blick auf die Rosen im Garten frei.
Es ist früher Nachmittag, Klaus Seidel steht in der Tür, eben hat er noch mal sorgfältig die Haare gekämmt. Drei Wochen ist die Flucht aus der Schweiz her. Er hat angezogen, was ihm für sich selbst am besten gefällt, sportlicher Chic: Jeans und kariertes Hemd, dazu eine Wolljacke mit Reißverschluss. Er spricht langsam, aber sehr deutlich. Es dauert ein bisschen, bis er auftaut; zuerst muss er die Angst überwinden, dass man ihn abführen und in eine Schweizer Pflegeeinrichtung bringen will.
Als er hier angekommen war, meldeten die Verwandten Klaus Seidel sofort im Rathaus an. Ein paar Tage später hatten sie einen Termin bei einer Ärztin, die sich mit Pflegefällen auskennt. Sie nahm sich lange Zeit. Die Diagnose „mittelschwere bis schwere Demenz“ und „Urteilsunfähigkeit“ hält sie für falsch. Ein psychiatrisches Gutachten soll folgen.
Er vermisst seine Frau - und die Schweiz
Der Schlaganfall habe Klaus Seidel zugesetzt, urteilt die Ärztin. Er sei unabhängig davon „altersvergesslich“. Klaus Seidel sei weder selbst- noch fremdgefährdend, er brauche allerdings Menschen, die nach ihm sehen. Sie hat erst mal das starke Antipsychotikum abgesetzt; es war ihm in der Schweiz verordnet worden. Seither spricht er besser und kann klarer denken. Dann verschrieb sie Ergotherapie. Einige Behandlungstermine hat er hinter sich, es geht ihm immer besser. Seidel hat viel zu tun, auch das tut ihm gut: Er begleitet seinen Bruder, der im Rollstuhl sitzt, zum Einkaufen und zum Kegeln, er trinkt ab und zu einen kleinen Whiskey, er hat am Wochenende die Rosen so akkurat gestutzt, wie sie hier noch nie gestutzt wurden, den Abfall in Säcke gepackt und zum Müllplatz getragen. Die Ärztin sagt: Er wird vorbildlich betreut. Da könnten sich viele Menschen in Deutschland ein Beispiel nehmen. Einer wie Klaus Seidel müsse in kein Heim.
Eine schöne Geschichte könnte das sein: darüber, wie eine Familie mit einem 88-jährigen Mann umgeht, der nicht mehr so kann wie früher. Wäre da nicht die Schweiz, die Klaus Seidel fehlt. Wenn man ihn fragt, wie er sich in seinem neuen Zuhause fühlt, dann starrt er eine Weile traurig vor sich hin und sagt: „Gut. Aber ich will doch meine Frau sehen. Und da sind doch auch noch mein Geld und das Haus und mein Auto.“
Die KESB will sich zu dem Fall nicht äußern. Sie hat inzwischen ein „polizeiliches Verfahren zur Rückführung“ von Klaus Seidel eingeleitet und prüft außerdem, ob die Staatsanwaltschaft wegen der „Entführung Urteilsunfähiger“ eingeschaltet wird. Ein Berufsbeistand ist ernannt worden, der Seidels Vermögen, laut Familie insgesamt um die 80.000 Franken, 77.000 Euro, verwaltet. Das Haus wurde nicht mit einbezogen, denn es gehört seiner Frau.
Der Anwalt, den Helmut Seidel beauftragt hat, versichert: Deutschland wird Klaus Seidel bestimmt nicht zwingen, in die Schweiz zurückzukehren. Im Grundgesetz ist klar geregelt, dass er als deutscher Staatsbürger keine Auslieferung zu befürchten hat.
Aber dass der alte Mann in seinem Leben noch einmal nach Altdorf reisen und seine Ehefrau sehen wird, ist unwahrscheinlich. Es wird genauso sein wie damals für Flüchtlinge aus der DDR, fürchtet seine Familie: Wer einmal geht, der geht für immer.