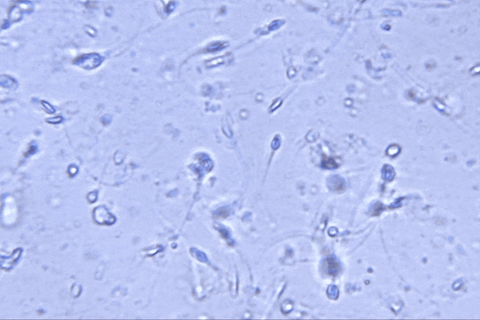"Zu wenig Selbstbewusstsein" ist keine medizinische Diagnose und muss auch nicht immer gleich vom Therapeuten behandelt werden. Wer nicht unter hohem Leidensdruck steht, sondern lediglich dank soliderem Selbstbewusstsein im Beruf erfolgreicher (oder in der Partnerschaft glücklicher) sein möchte, kann auch per Selbsthilfe einiges für sein "Ich" tun. Da die Struktur unserer Persönlichkeit bewusst nur schwer zu verändern ist, darf niemand glauben, er könne sich ein neues Ich zurechtzimmern. Was immer geschäftstüchtige Motivationstrainer behaupten: So etwas gelingt nicht. Doch meist sind es schon die kleinen Schritte, die das entscheidende Stück Lebensqualität bringen und das Vertrauen ins Selbst wieder herstellen können.
Zum Beispiel:
> Sich weiterbilden: Fachliche Kompetenz steigert das Selbstwertgefühl im Beruf.
> Einen Rhetorik-Kurs besuchen: Wer gelernt hat, Stimme und Sprache bewusst einzusetzen, lässt sich im Gespräch nicht mehr so leicht unterkriegen.
> Hobbys pflegen: Eine kreative oder ungewöhnliche Freizeitbeschäftigung kann eine Ich-stärkende Herausforderung sein.
> Sport treiben: Selbstbewusstsein beginnt mit einem guten Körpergefühl.
> Entspannungstechniken lernen: Mit autogenem Training, Muskelentspannung oder Yoga lassen sich Stresssituationen besser bewältigen, was wiederum bestätigende Erfolgserlebnisse bringt.
Sollten schwerer wiegende Probleme vorliegen - wenn man im Job untergebuttert wird oder sich in Partnerschaft oder Familie nicht genügend von Forderungen abzugrenzen vermag -, dann kann ein Selbstsicherheitstraining helfen. Besonders geeignet ist das Training in einer Gruppe unter Anleitung eines Therapeuten. In Rollenspielen können Angst auslösende Situationen simuliert und neue Verhaltensweisen so lange geübt werden, bis man sich traut, sie auch in "freier Wildbahn" auszuprobieren. Rückmeldungen der anderen Teilnehmer sind dabei eine wichtige Hilfe zur Selbsteinschätzung. Manche Therapeuten arbeiten auch mit Videoaufzeichnungen, so dass der Klient sich in seiner Haltung, seinen Worten und Gesten selbst wahrnehmen und analysieren kann. Angeboten werden solche Trainings von Beratungsstellen, Volkshochschulen und psychotherapeutischen Praxen als so genannte "Individuelle Gesundheitsleistungen" (IGeL), die nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Falls eine krankheitswertige Diagnose, etwa "soziale Ängste", vorliegt, ist in Absprache mit der Krankenkasse auch die Kostenübernahme eines Gruppentrainings möglich.
Wichtig: Ein nach dem Psychotherapeuten-Gesetz zugelassener Therapeut sollte die Gruppe leiten, denn gerade solche Kurse werden häufig von Schwätzern und Wichtigtuern angeboten. Informationen zu geeigneten Therapeuten erhält man über die Psychologen-Berufsverbände BDP und DPTV sowie den Psychotherapie Informations Dienst (PID).
Wenn die Probleme mit dem Selbstwertgefühl mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Ängsten oder auch Essstörungen und Suchtkrankheiten im Zusammenhang stehen, müssen diese vorrangig kuriert werden. Dabei steht zunächst die Behandlung der akuten Krankheits- symptome im Vordergrund, etwa die medikamentöse Therapie einer Depression oder die Regulierung selbst schädigenden Essverhaltens. Anschließend kann in der Psychotherapie an der Stärkung des Selbstwertgefühls gearbeitet werden.
In einer tiefenpsychologischen Therapie beispielsweise werden dabei Konflikte und Beziehungs- muster aus den ersten Lebensjahren, in denen sich das Selbstwertgefühl gebildet hat, aufgenom- men und bearbeitet. So kann es sein, dass ein Patient von einer Mutter eher als Partnerersatz denn als Kind gesehen wurde und sich, da er diese Rolle als kleiner Junge natürlich nicht ausfüllen konnte, auch im späteren Leben ständig überfordert fühlt. Macht er sich dieses Muster bewusst, kann er es schließlich überwinden und zu einem autonomen Selbst gelangen.
In einer Verhaltenstherapie dagegen wird weniger nach der Entstehung eines negativen Selbstbildes gefragt. Nach dem Prinzip der "kognitiven Umstrukturierung" lernt der Patient statt dessen, seine aktuellen Wahrnehmungen - "Ich kann gar nichts, ich bin in allem ein Versager" - zu beobachten und zu analysieren, um sie dann durch realistischere Einschätzungen zu ersetzen: "Ich habe meine Schwächen - aber auch meine Stärken."