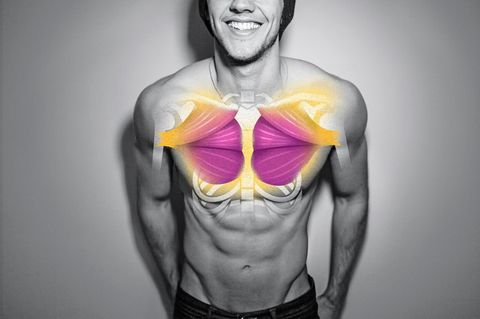Für eine Weile nur die Lieblingsband auf dem Ohr haben, dem Lärm der Außenwelt entfliehen. Vor allem Jugendliche und junge Menschen drehen den Lautstärkeregler gern bis zum Anschlag auf. So weit, bis sie wirklich gar nichts anderes mehr hören müssen. So laut, bis die Ohren irgendwann kapitulieren. Wie eine große weltweite Studie nun herausgefunden hat, läuft deswegen eine ganze Generation Gefahr, ihr Gehör dauerhaft zu schädigen.
Als Grundlage der Meta-Analyse nutzten Forscher:innen wissenschaftliche Artikel zu Hörpraktiken von Menschen zwischen 12 und 34 Jahren, die zwischen des Jahren 2000 und 2021 veröffentlicht wurden. Drei Datenbanken dienten als Quelle. Als unsichere Hörpraktiken wurden das Kopfhörertragen und Aktivitäten wie Club- und Barbesuche sowie Konzerte eingestuft. Die Ergebnisse, die jetzt in der Fachzeitschrift "BMJ Global Health" veröffentlicht wurden, sind alarmierend. Lauren Dillard, Hauptautorin der Studie und Beraterin der Weltgesundheitsorganisation, fasst es für "CNN" so zusammen: "Wir schätzen, dass weltweit 0,67 bis 1,35 Milliarden Menschen im Alter von 12 bis 34 Jahren wahrscheinlich unsichere Hörpraktiken anwenden". Damit seien sie dem Risiko eines Hörverlusts ausgesetzt.
Hörprobleme schon durch zu laute Musik über Kopfhörer
Die Studie fußt auf einem altbekannten Problem: Ist die Lautstärke zu hoch, kann das zu Verletzungen im Ohr führen, weil die Sinneszellen geschädigt werden. Je nach Frequenz liegt die Schwelle, die nicht überschritten werden sollte, bei 120 bis 140 Dezibel. Im Extremfall, kann es zu einem sogenannten akustischen Trauma kommen. Dies äußert sich zunächst durch stechende Ohrenschmerzen, in der Folge kann es zu einem Tinnitus und/oder gemindertem Hörvermögen kommen – auch dauerhaft.
Hörprobleme können aber schon durch weit geringere Lärmbelästigungen hervorgerufen werden. Ab einer Lautstärke von etwa 80 bis 85 Dezibel gilt das Risiko für eine Lärmschwerhörigkeit als erhöht. Abhängig ist das einerseits von der individuellen Lärmempfindlichkeit, andererseits von der Dauer der Lärmbelastung. Eine solche Lärmbelästigung können laute Maschinen sein, die Handwerker regelmäßig bei der Arbeit einsetzen oder auch eine zu laute Musikbeschallung im Club.
Hörverlust: "Was da kaputt geht, bleibt kaputt"
"Was da kaputt geht, bleibt kaputt", erklärt der Arzt Bernhard Junge-Hülsing knapp gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Im Laufe der Zeit kann sich eine chronische Lärmschwerhörigkeit entwickeln, die der Altersschwerhörigkeit ähnelt und die im schlimmsten Fall zum kompletten Hörverlust führen kann. Daher sollten beispielsweise auch Kopfhörer in Maßen genutzt werden – das betrifft die Tragedauer, aber auch die Lautstärke. So sei es nicht gut, drei Stunden am Stück Kopfhörer zu nutzen. Er sagt: "Die Ohren brauchen regelmäßige Lärmpausen."
Denn auch das simple Hören über Kopfhörer kann das Gehör schädigen. Laut Studie drehen die Hörer:innen die Lautstärke beispielsweise beim Smartphone oft höher als es dem Ohr gut tut – auf bis zu 105 Dezibel. Dillard empfiehlt daher, Kopfhörer zu nutzen, welche die Umgebungsgeräusche reduzieren, also mit sogenanntem Noise Cancelling arbeiten. Auf Konzerten oder Clubs sollte Abstand von den Lautsprechern gewahrt werden, Gehörschutz wie Ohrstöpsel wirken Schädigungen des Gehörs entgegen.
Quelle: BMJ, CNN, Gesundheitsinformation, RND