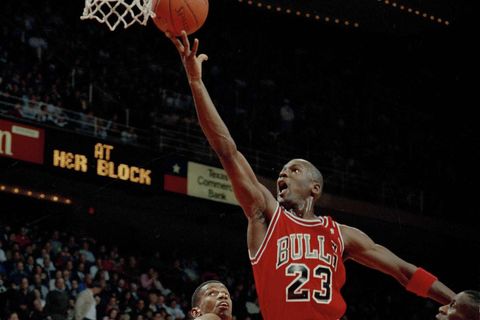In der Praxis wird immer eine Kombination von Methoden angewendet, individuell zugeschnitten auf den jeweiligen Patienten. Man unterscheidet zwischen Frühinterventionen, dem akuten Entzug und der anschließenden Rehabilitationsbehandlung:
Frühinterventionen
Die Medizin setzt mehr und mehr darauf, Alkoholismus schon in der Entstehungsphase zu bekämpfen. Vor allem Hausärzte sprechen die Patienten auf ihren erhöhten Konsum an und informieren sie über gesundheitliche Risiken. Mit Erfolg: Eine Studie zeigt, dass schon ärztliche Maßnahmen, die weniger als 30 Minuten dauern (etwa Gespräche), mehr als die Hälfte der Patienten dazu bewegen, weniger zu trinken.
Entzugstherapien
Grundsätzlich sollte ein Entzug nie abrupt, sondern immer schrittweise erfolgen, um körperlich riskante Entzugssymptome zu vermeiden.
Ambulanter Entzug:
Oft kann der Entzug zu Hause, aber mit täglichem Besuch beim Arzt oder in der Ambulanz einer Klinik erfolgen. Dabei reduziert der Patient innerhalb von fünf Tagen schrittweise seine Trinkmenge auf null. Nicht geeignet für Patienten, die sehr viel trinken, bei denen in der Vergangenheit bei einem Entzug Krampfanfälle oder Delirien aufgetreten sind, sowie für Abhängige aus ungünstigen Sozialverhältnissen. In diesen Fällen ist immer ein stationärer Entzug geboten.
Teilstationärer Entzug:
Der Patient verbringt den Tag in einer Klinik, verbleibt aber ansonsten in seinem Umfeld. Diese Entzugsform ist besonders geeignet für Patienten, die noch sozial integriert sind und bei denen die Krankheit noch nicht weit fortgeschritten ist.
"Qualifizierter stationärer Entzug":
Der Patient bleibt mindestens drei Wochen auf einer speziellen Suchtstation einer psychiatrischen Klinik und macht dort den körperlichen Entzug durch. Zusätzliche therapeutische Maßnahmen sollen ihm helfen, sein Verhalten und seine Lebensführung zu verändern, um abstinent zu bleiben.
Medikamentöser Entzug:
Ambulant werden bei etwa einem Drittel, stationär bei 80 Prozent der Patienten zusätzlich Medikamente eingesetzt, um die Entzugserscheinungen zu mindern. Nachweislich wirksam sind Clomethiazol und Benzodiazepine, die jedoch ihrerseits abhängig machen können. Bei leichteren Entzugserscheinungen können Clonidin, Tiaprid und Carbamazepin ausreichend helfen. Etwa fünf Prozent der Patienten mit Entzugserscheinungen entwickeln ein Delirium mit Halluzinationen und Störungen des Bewusstseins - ein lebensbedrohlicher Zustand, der auf der Intensivstation behandelt werden muss.
Rehabilitationstherapien
An den körperlichen Entzug sollte sich immer eine psychotherapeutische Behandlung anschließen, um die Abstinenz zu sichern. Diese kann stationär in einer sogenannten Langzeittherapie über vier bis sechs Monate erfolgen oder ambulant mit ein bis zwei Sitzungen pro Woche über mindestens ein Jahr, allein oder in der Gruppe. Ambulant liegen die Abstinenzraten nach einem Jahr bei 50 bis 60 Prozent, stationär nach 18 Monaten bei 53 Prozent, nach vier Jahren noch bei 46 Prozent - wobei zu beachten ist, dass mit dieser Therapieform die deutlich schwereren Fälle behandelt werden. Die eingesetzten Techniken sind stationär und ambulant weitgehend identisch:
Verhaltenstherapie:
Da Alkoholismus sich im (Trink-)Verhalten manifestiert, kommt dieser Therapieform eine besondere Bedeutung zu. Der Patient analysiert, welche äußeren Bedingungen - etwa Stress oder Vorbilder - Auslöser für sein Verhalten sind und welche Ziele - etwa Entspannung oder Geselligkeit - er mit dem Alkoholkonsum eigentlich verfolgt. Darauf aufbauend werden alternative Verhaltensweisen entwickelt und geübt, um diese Ziele zu erreichen. Dabei setzt die Verhaltenstherapie eine Kombination verschiedener Techniken ein:
Aufbau von Selbstmanagement: Hierzu gehören etwa Abstinenzverträge, Belohnungssysteme und Trinktagebücher, in denen der Patient seine trockenen Tage, aber auch eventuelle Rückfälle aufschreibt.
Rückfallprophylaxe und -management: Der Patient identifiziert Situationen, in denen er den Drang verspürt, Alkohol zu trinken. In Rollenspielen wird ein adäquates Verhalten eingeübt. Der Betroffene soll auch Techniken entwickeln, einen eventuellen Rückfall wieder zu beenden.
Soziales Kompetenztraining: Anlass für den Konsum von Alkohol sind häufig unangenehme Gefühle, die durch zwischenmenschliche Konflikte entstehen. Der Patient lernt, solche Konflikte zu vermeiden oder produktiv zu lösen, etwa indem er seine Gefühle ausdrückt. Geübt wird auch, alkoholische Getränke abzulehnen.
Stressbewältigung: Der Patient identifiziert Stressituationen - also Situationen, in denen er besonders rückfallgefährdet ist. Es wird überprüft, inwieweit sich die äußeren Bedingungen verändern lassen und welche alternativen Möglichkeiten zur Entspannung es gibt.
Reizexpositionsverfahren: Ähnlich dem Training etwa gegen Höhenangst soll der Patient bei dieser Technik lernen, eine Situation zu meistern, ohne das bisherige Verhalten zu zeigen, also zur Flasche zu greifen. Manche Therapeuten konfrontieren den Betroffenen dazu auch direkt mit alkoholischen Getränken.
Paar- und Familientherapie:
Konflikte in der Familie können sowohl Ursache als auch Folge einer Alkoholabhängigkeit sein. Im Gespräch mit allen Beteiligten werden destruktive Beziehungsmuster analysiert und neue, positive entwickelt.
Weitere Maßnahmen
Selbsthilfegruppen:
Zur Wirksamkeit von Selbsthilfegruppen, vor allem zur Langzeitprophylaxe, gibt es nur wenige Studien. In einer Untersuchung zum 12-Punkte-Programm der Anonymen Alkoholiker erwies sich dieses als ebenso wirksam wie eine Verhaltenstherapie. Mediziner empfehlen Selbsthilfegruppen als Ergänzung zu anderen Maßnahmen.
Medikamentöse Rückfallprophylaxe (Anti-Craving-Mittel):
Seit einigen Jahren sind Substanzen auf dem Markt, die das Verlangen nach Alkohol dämpfen sollen. Nachgewiesen ist die Wirkung aber nur für die beiden Stoffe Acamprosat und Naltrexon. Zudem kann bei sorgfältiger Überwachung durch einen Arzt Disulfiram als Aversivtherapeutikum eingenommen werden (Disulfiram ist kein Anti-Craving- Medikament, es führt zu unangenehmen Empfindungen nach Alkoholeinnahme).
Kontrolliertes Trinken:
Dabei legt der Patient fest, wann und wo er höchstens wie viel trinken möchte. Die Ergebnisse protokolliert er in einem Trinktagebuch. Zur Behandlung einer Abhängigkeit ist diese Therapiemethode nach wie vor umstritten, die Studienlage ist widersprüchlich. Allerdings kann das kontrollierte Trinken offenbar Patienten motivieren, für die eine Abstinenz zunächst inakzeptabel ist - und manch einer schafft darüber doch den Schritt ins Trockene.