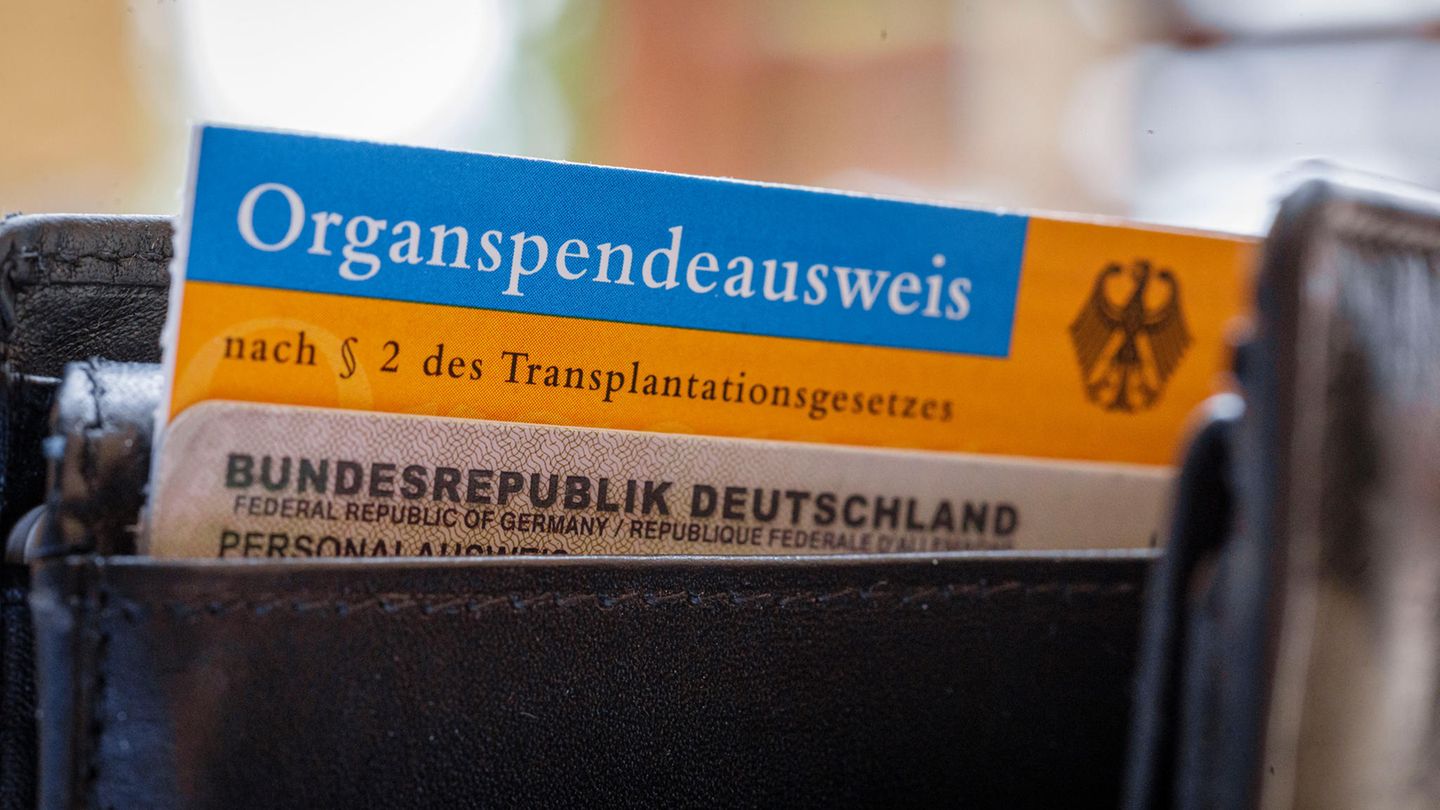Gehofft hatten sie wie alle, die auf den Wartelisten für ein Spenderorgan stehen. Doch für 650 Kranke wurde bei uns vergangenes Jahr die Zeit zu lang. Sie starben, bevor ihnen geholfen werden konnte. Die Zahl stammt von Eurotransplant, jenem Verbund, der von den Niederlanden über Deutschland bis Kroatien reicht und für rund 140 Millionen Menschen die Vergabe von Nieren, Herzen, Lebern, Lungen oder Bauchspeicheldrüsen koordiniert.
Auch in diesem Jahr stehen in dieser Statistik schon wieder 40 "Abgänge" oder "Removals" durch Versterben, wie das in der Fachsprache heißt. Gleichzeitig aber hat es allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 725 neue Einträge gegeben – Patienten, deren Überleben davon abhängt, so bald wie möglich Ersatz für ein eigenes, verschlissenes Organ zu erhalten. 8500 Menschen befinden sich derzeit insgesamt in Deutschland in dieser heiklen Lage. Doch starben beispielsweise vergangenes Jahr nur 965 erklärte Spender, deren Organe transplantiert werden konnten. Das krasse Missverhältnis ist offensichtlich.
Neues Organspende-Register mit technischen Hürden
Abhilfe soll jetzt unter anderem ein Online-Register schaffen, das bereits vor vier Jahren vom Bundestag beschlossen worden war. Um sich dort eintragen zu können, braucht es zwar kein Informatik-Studium, aber doch einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion samt 6-stelliger PIN, eine Krankenversichertennummer und eine E-Mail-Adresse, dazu ein Smartphone oder einen Computer mit der "AusweisApp", Version 2. Die stiftet der Bund, um die in einem Chip des Personalausweises verborgene Online-Funktion überhaupt nutzen zu können.
Alles klar? Es könnte doch so einfach sein, denken sicher manche, auch der Autor dieser Zeilen. Warum zum Beispiel nicht "Opt-out" statt "Opt-in"?
Hinter diesen international üblichen Kürzeln stecken zwei grundverschiedene Modelle, die Organspende zu organisieren. Im ersten Fall muss ich nur aktiv werden, wenn ich nicht bereit bin, mir nach dem Tod Organe oder Gewebe entnehmen zu lassen. Ich bin dann "out" aus dem Pool möglicher Spender, zu dem automatisch alle anderen gehören, wenn sie nicht ebenfalls amtlich widersprochen haben.
Für dieses einfache Modell aber fand sich in Deutschland keine Mehrheit. Deshalb gilt bei uns das umgekehrte Verfahren: Wer sich nicht ausdrücklich zur Verfügung stellt, kommt bei der Suche nach einem Organ nicht infrage.
Ist einer Entnahme nicht ausdrücklich widersprochen worden, können beim Tod eines Menschen zwar noch Angehörige befragt werden und gemeinsam mit dem medizinischen Team zur Auffassung gelangen, dass es doch im Sinne des oder der Verstorbenen ist, ein Organ oder Gewebe zu spenden. Aber man will sich solche Gespräche – quasi am Sterbebett, womöglich mit noch laufenden Maschinen zum Erhalt der Kreislauffunktionen des Hirntoten –, gar nicht ausmalen. Zweifellos sind solche Entscheidungen für alle eine Zumutung.
Bei "Opt-out" käme es auch gar nicht dazu. Doch die einfachere Variante ist halt keineswegs auch die beliebtere. Untersuchungen zeigen, dass die "Opt-in"-Entscheidung mit maximaler persönlicher Freiheit von einer Mehrheit in der Bevölkerung bevorzugt wird – nicht überall in Europa, aber nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in den Niederlanden, wo eine entsprechende Regelung bereits 1996, ein Jahr vor der deutschen, eingeführt wurde. Allerdings zeigten wissenschaftliche Befragungen auch, dass überhaupt nur ein knappes Drittel der Menschen wusste, welches rechtliche Verfahren im eigenen Land galt. Wie soll es dann zu einer Entscheidung kommen?
Beim Thema Organspende neigen wir zum Verdrängen
Dass es eine Menge Aufklärung braucht, ist bei einem so heiklen Thema selbstverständlich. Es gibt auch viele Angebote, ganze Kampagnen, Broschüren zuhauf und Online-Seiten mit Antworten auf alle nur denkbaren Fragen rund um die Organspende. Doch wird all das eher verhalten genutzt. Solange nichts drängt, fällt es offensichtlich schwer, sich mit dem eigenen Lebensende zu befassen, schließlich gar zu einer Entscheidung zu kommen.
Das zeigt auch die Verbreitung von Patientenverfügungen oder Vollmachten für den Fall, dass man selbst nicht mehr fähig ist, über sein Leben zu bestimmen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Doch Schätzungen für den Bundestag kamen vor einigen Jahren auf 4,7 Millionen Vorsorgevollmachten und 3,5 Millionen registrierte Patientenverfügungen. Und das bei 84 Millionen Menschen im Land, die allesamt in eine Lage kommen werden, in der solche Dokumente wichtig werden – todsicher. Menschen mit dieser Zwangsläufigkeit sanft, aber deutlich zu konfrontieren, verspricht am ehesten, dass die Haltung zur Organspende überdacht oder überhaupt erst gefunden wird. Jedenfalls legen das einige Studien und Feldversuche der vergangenen Jahre nahe. Die Datenlage ist nicht üppig. Aber sie zeigt zumindest Tendenzen.
Natürlich neigen wir alle mehr oder weniger stark zum Verdrängen. Wer will sich schon der eigenen Endlichkeit stellen, wenn nichts wehtut und die Sonne scheint? Wird man aber behutsam darauf gestoßen, etwa durch geschulte Fachleute, kann das den Ausschlag geben. Ein Team von Marketingspezialisten kanadischer und US-amerikanischer Universitäten zum Beispiel fand dabei vor einigen Jahren heraus, dass "reziproker Altruismus" als Ansatz besonders überzeugend wirkt. Damit sind im Grunde ganz simple Appelle gemeint. So zum Beispiel: "Wenn Sie selbst ein Spenderorgan bräuchten, würden Sie eines annehmen? Wenn ja, helfen Sie bitte Leben zu retten und lassen sich noch heute registrieren." Von allen getesteten Verfahren führte allein diese "Stell-Dir-doch-mal-vor"-Methode zu einer signifikanten Steigerung der Registrierungszahlen. Und wo stellt man solche Fragen? In Schulen zum Beispiel, nicht erst im Altenheim.
Ja, es schmerzt, sich in eine Lage hineinzuversetzen, in der das eigene Leben vollkommen vom Wohlwollen der anderen abhängt. Aber nur, wer diesem Gedanken nicht ausweicht, ihn nicht verdrängt, die Verzweiflung sogar am eigenen Leibe gespürt oder bei einem nahestehenden Menschen erlebt hat, kann wenigstens ansatzweise verstehen, wie es ist, dann niemanden zu finden, der hilft. Wie es ist, kein fremdes Organ angeboten zu bekommen, wenn die eigenen Kräfte mit jedem Tag nachlassen und die Zeit verrinnt. Wir müssen wohl dem Tod ins Auge sehen, wenigstens gedanklich, um das fassen zu können.
Und wen das zu überwältigen droht, der kann es auch nüchterner haben. "Reziproker Altruismus" lässt sich nämlich auch ganz einfach übersetzen: Wie du mir, so ich dir. Das kann auch begreifen, wer nicht auf einer Warteliste steht. Es braucht dafür nicht einmal Mitgefühl mit denen, deren Zeit schon knapp wird. Ein bisschen Logik reicht: Die Organspende kann nicht funktionieren – mit oder ohne Online-Register –, wenn in einer Gesellschaft die meisten zwar haben, aber lieber nicht geben wollen.