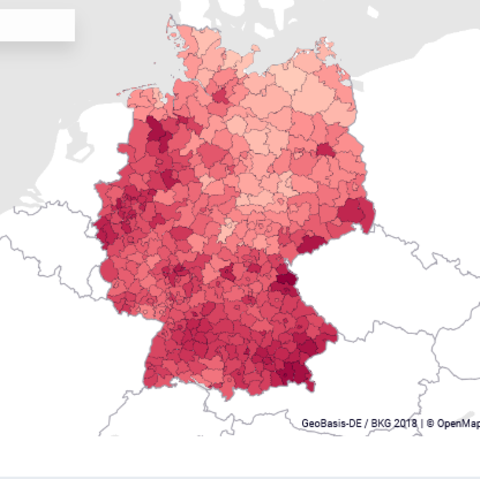Zunächst waren es die Neuinfektionen, später die Verdopplungszeit – und jetzt die Reproduktionszahl R. Die Kennzahlen, die während der Covid-19-Pandemie im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wechseln sich ab. Die Verkündung neuer Werte wird von Teilen der deutschen Bevölkerung mit fast so viel Spannung verfolgt, wie die Ziehung der Lottozahlen oder die Bekanntgabe von Bundesliga-Ergebnissen (in normalen Zeiten) in der Sportschau.
Nun ist es also die Reproduktionszahl R: Der Wert ist eine der zentralen Kennzahlen zur Beurteilung des Verlaufs einer Infektionswelle. R gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter in einem bestimmten Zeitraum im Durchschnitt ansteckt. Je niedriger R ist, desto besser:
Liegt R unter 1, steckt ein Infizierter im Schnitt weniger als einen anderen Menschen an - und die Epidemie läuft aus.
Liegt R bei 1, verläuft die Zahl der Neuinfektionen konstant und linear. Die Kurve steigt also nicht (mehr) exponentiell.
Liegt R über 1, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen anderen Menschen an - die Zahl der täglichen Neuinfektionen wird größer. Angela Merkel hat dies bei einer Pressekonferenz vor kurzem äußerst anschaulich erklärt:
Hinweis: Die tagesaktuelle Reproduktionszahl erfahren Sie im obenstehenden Video
Wie wird die Reproduktionszahl R berechnet?
Die Ermittlung der Reproduktionsrate ist wegen verschiedener Faktoren und Schätzungen komplex. Zudem gibt es verschiedene Berechnungsansätze:
- Das RKI berechnet R demnach statistisch als Trend (Nowcasting). Dafür werden die Meldezahlen, welche vier Tage auseinanderliegen (so der definierte untersuchte Zeitraum), mit einer Rechen- und Schätz-Methode verglichen. Diesem Verfahren liegt den Angaben zufolge das in den jeweiligen Meldungen angegebene Erkrankungsdatum zugrunde - welches etwa zwei Wochen früher liegt. Das RKI verwendet für die Ermittlung nicht nur die Anzahl der gemeldet Neuinfektionen, sondern sondern auch die aus diesen in einem vorgelagerten Schritt geschätzten Neuerkrankungen. Laut RKI ist die Zahl mit einer statistischen Unsicherheit behaftet, unter anderem weil die Zahl der Neuinfektionen mit einer Verzögerung eingerechnet werde. Somit bildet die aktuelle Reproduktionszahl laut RKI-Vize Lars Schaade stets die Infektionsrate von vor etwa eineinhalb Wochen ab
Am 12. Mai hat das RKI bekanntgegeben, künftig auch einen geglätteten R-Wert herauszugeben. Der neue Wert soll kurzfristige Ausschläge wie etwa zuletzt die gehäuften Infektionen in Schlachthöfen besser ausgleichen
- Nach einem Ansatz des Helmholtz-Zentrums für Infektiologie (HIZ) in Braunschweig und der Ludwig-Maximilians-Universität München wird R den Angaben nach hingegen infektionsepidemiologisch anhand typischer Krankheitsverläufe modelliert. Diese Schätzung gibt den Wert R für den Tag an, an dem die Meldezahlen beim RKI verfügbar sind. Das HIZ kam so auf den weitaus niedrigeren Wert von 0,57 (Datenstand: 23. April).
Beide Verfahren haben einen unterschiedlichen Schwerpunkt: Im ersten Fall (RKI) geht es um das Melde- und Übermittlungsgeschehen, im zweiten (HIZ) um das vermutliche Erkrankungsgeschehen. Die Krux dabei ist, dass – etwa bei Pressekonferenzen – die genauen Rechenwege und Einflussfaktoren oft kaum kommuniziert werden.
Wo liegen die Tücken bei der Berechnung der Reproduktionszahl R?
Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) weist in seinem Newsletter "Unstatistik" mit Blick auf den Nowcast vom RKI darauf hin, dass es sich bei der Reproduktionszahl um eine Schätzung mit "nicht unerheblichem Schätzfehler" handele. Dieser müsse bei der Bewertung der aktuellen Lage stets berücksichtigt werden. Daher seien selbst Meldungen darüber, dass R wieder auf 1 gestiegen sei, nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis, da dieser Anstieg durchaus innerhalb des Schätzfehlers schwanken könne, etwa zwischen 0,8 und 1,1, wie das RKI etwa am 9. April angab.
Desweiteren hat unter anderem auch die Zahl der durchgeführten Tests und der erfassten Infektionen einen Einfluss auf die Reproduktionszahl. Sprich: Werden mehr Tests durchgeführt, werden mehr Infektionen erfasst. Die Dunkelziffer wird kleiner. "Damit wird jedoch wiederum das geschätzte R tendenziell ansteigen, ohne dass sich in der Realität der Infektionsverlauf geändert hat", schreibt das RWI.
Daher rät das Institut dazu, die Reproduktionszahl R trotz ihrer großen Bedeutung für die Einschätzung des Pandemieverlaufs vorsichtig zu interpretieren.
Was ist der Unterschied zwischen R und R0?
Neben der Reproduktionszahl R, war vor allem zu Beginn der Pandemie häufiger auch von der Basisreproduktionszahl R0 die Rede. Mitunter wurden die Werte fälschlicherweise gleichgesetzt.
Die Basisreproduktionszahl R0 beschreibt quasi den "Startwert" zu Beginn einer Pandemie, wenn es noch keine Immunität gibt und die gesamte Bevölkerung einer Infektion gleichsam ausgesetzt ist. Laut RKI wird R0 beim Coronavirus verschiedenen Studien zufolge zwischen 2,4 und 3,3 verortet.
Verändert sich der Wert, etwa nach der Ergreifung von Maßnahmen, ist von der effektiven Reproduktionszahl R die Rede.
Hinweis: In einer früheren Version des Textes hieß es, "(... ) am Mittwoch (29. April) hat das RKI bestimmte Parameter bei der Berechnung geändert (...)". Das war nicht ganz korrekt. Der Absatz wurde entfernt