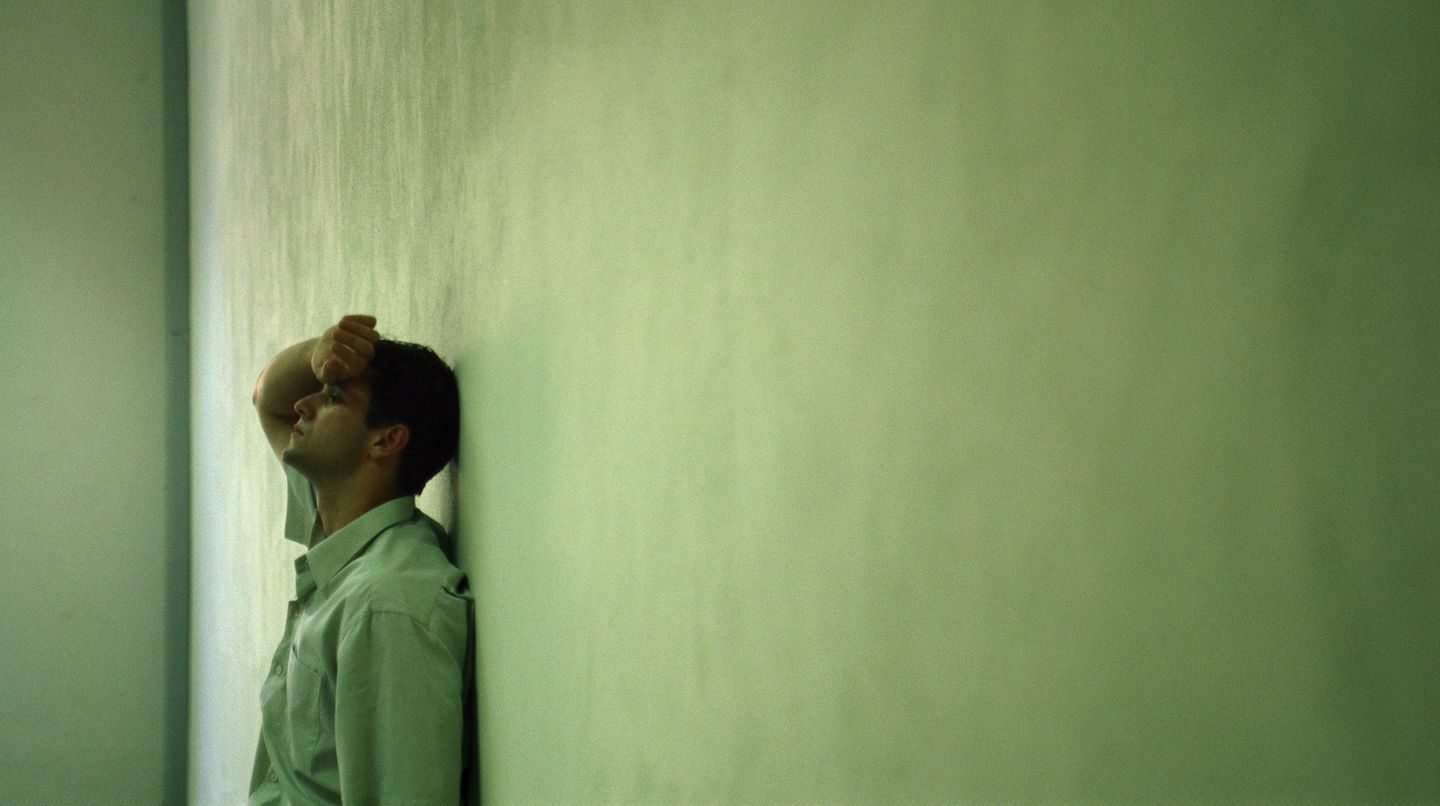Herr Schmidt-Möck, welche Rolle spielt Scham für das Verhalten eines Süchtigen?
Scham bedeutet ursprünglich verdecken, verhüllen, verstecken und vermeiden. Jemand, der süchtig ist nach Alkohol, Drogen, Tabletten, Glücksspielen oder etwas anderem, will natürlich nicht zeigen, wie abhängig er ist, und tut alles, um mögliche Hinweise darauf zu vertuschen. Doch je mehr ich etwas verstecke, desto tabuisierter ist es, desto stärker arbeitet es in mir drin und wird immer mächtiger. Dadurch wird die Hürde, mich damit zu zeigen, jeden Tag größer.
Psychologen sprechen von einem Teufelskreis von Sucht und Scham.
Wir alle haben bestimmte Vorstellungen von uns selbst, wie wir sein möchten oder glauben sein zu müssen, weil die Umgebung es von uns erwartet. In der Psychologie sprechen wir vom Ich-Ideal. Der Druck, dem idealen Selbstbild und den tatsächlichen oder vermeintlichen Ansprüchen anderer genügen zu müssen, ist nicht die einzige Ursache, aber ein wesentlicher Kern der Abhängigkeit. Jemand, der Suchtprobleme hat, verdeckt mit dem Suchtmittel seine Grenzen und überspielt, dass er nicht so schnell, leistungsfähig, gelassen, attraktiv oder redegewandt ist, wie er es gerne wäre. Durch das Suchtmittel erleichtert er sich den inneren Druck. Dann ist der Zensor im Kopf leiser, der immer sagt: Du bist zu dick. Du bist zu langsam. Du kannst keine Vorträge halten. Du hast sowieso keine Chancen bei Frauen et cetera. Man hört ihn zeitweise gar nicht mehr. Wenn dann allerdings am nächsten Morgen das große Erwachen kommt, meldet sich die Stimme sehr schmerzhaft wieder und mit ihr der Selbstekel und das Gefühl, versagt zu haben. Um das zu kompensieren, braucht man noch mehr von der Droge. Ab einem bestimmten Punkt kann man ohne Suchtmittel nicht mehr existieren. Der Suchtkreislauf koppelt sich ab von den Ursprungsbedürfnissen. Dann braucht man Alkohol, Drogen oder Tabletten nicht mehr, um eine bestimmte Situation zu überspielen, sondern weil man abhängig ist.
Wie erlebt ein Abhängiger seine Scham?
Die Schamgefühle, die ein Süchtiger hat, kennt im Prinzip jeder. Scham ist brennend heiß und lässt einen im Boden versinken. Man möchte sich auflösen und nicht gesehen werden. Ich halte Scham neben Angst für eines der stärksten Gefühle. Jemand, der süchtig ist, will auf keinen Fall gesehen werden, während er sein Suchtmittel konsumiert, und erst recht nicht in dem kläglichen Zustand, in dem er hinterher ist. Süchtige schämen sich furchtbar, weil sie ihre Autonomie verloren haben und keine Kontrolle über ihren Körper, ihre Kraft und ihre Gedanken haben. Ich habe vor Kurzem mit einem Vater gesprochen, der sich unendlich vor seinen Kindern schämt, weil sie ihn immer wieder betrunken erlebt haben oder morgens in seinem Erbrochenen liegend. Es ist auch tief beschämend, wenn Menschen morgens nicht aus dem Bett kommen, weil sie so verkatert sind, und Angehörige sie zum Aufstehen zwingen müssen, damit sie nicht schon wieder bei der Arbeit fehlen. Bei Menschen, die sehr mit Scham zu kämpfen haben, kann das zu Depressionen und im schlimmsten Fall zu Selbstmord führen.
Manche Abhängige erzählen, dass sie zwar einerseits alles getan haben, ihre Sucht zu verstecken, gleichzeitig aber gehofft haben, entdeckt zu werden.
Es bindet sehr viel Energie und kostet unendlich Kraft, wenn man seine Gefühle, Schwächen oder Eigenarten verstecken muss. Das gilt nicht nur für Süchtige. Deshalb sehnt man sich im Grunde danach, das nicht mehr tun zu müssen. Aber die eigene Schamgrenze zu überwinden ist sehr schwer. Denn die Scham ist die Hüterin für unser Innerstes. Sie schützt unsere Intimität. Jeder Mensch ist ein Geheimnis, hat Geheimnisse - und ist sich selbst mitunter ein Geheimnis – und muss diese wahren, um interessant zu bleiben und eine Persönlichkeit zu sein. Gleichzeitig gibt es eine große Sehnsucht, gesehen und gehört und anerkannt zu werden - auch mit dem, wie man ist, auch mit all dem, über das man lieber schweigt. Kern der Scham ist die Angst, nicht anerkannt zu sein, wie man ist.
Wie stark ist diese Angst?
Oft kommt von Suchtkranken der Satz: Wenn mich jemand so sieht, werde ich ausgestoßen, nicht mehr geliebt, dann sterbe ich. Im inneren Erleben geht es also um Leben und Tod.
Und um das zu verhindern, verheimlichen, verstecken und lügen Abhängige?
Diese Abwehrstrategien sind nichts Suchtspezifisches. Wir tragen sie alle in uns. Lügen lernt man in der Regel sehr früh, und es ist auch eine Form von sozialer Kompetenz. Es ist wichtig, ein Bild von sich vermitteln zu können, mit dem man leben kann.
Zum Lügen gehört auch, sich selbst etwas vorzumachen. Ist dieses Muster bei Süchtigen stärker ausgeprägt?
Das weiß ich nicht, aber mir fällt dazu ein, dass Alkoholiker ihre Depots haben, im Auto, im Keller, in der Garage. Und dann müssen sie mal eben in der Garage etwas erledigen, und dort steht zufällig der Flachmann. Das gibt ihnen die Legitimation, sich und anderen zu sagen: Ich wasche das Auto oder: Ich räume die Garage auf. Dass sie nebenbei zur Flasche greifen, nehmen sie vielleicht selbst kaum noch wahr.
Viele Süchtige bringen ihre Angehörigen dazu, das Versteckspiel mitzuspielen.
Scham betrifft nicht nur die Süchtigen. Kinder schämen sich ihrer alkoholabhängigen Eltern, die Ehefrau schämt sich ihres Mannes und umgekehrt. Deshalb decken Angehörige die Sucht, solange es möglich ist. Scham hat auch eine soziale Funktion. Für Angehörige ist es schwierig, darüber zu sprechen, weil sie ahnen, dass sie an der Sucht mit beteiligt sind. Ich glaube, dass Abhängigkeit nur in sozialen Zusammenhängen, in sozialen Systemen zu denken ist. Eine Familie, eine Gruppe oder ein Team, letztlich die ganze Gesellschaft sind immer an der Sucht be¬teiligt. Deshalb ist die eigentliche Hürde für den Erfolg eines Entzugs oder einer Rehabilitation immer der Zeitpunkt, an dem die Menschen aus der Klinik entlas¬sen werden und in ihr Umfeld zurückkehren. Dort im Alltag der Familie, der Arbeit und der Freunde entscheidet sich, ob sie rückfällig werden oder nicht.
Um Hilfe zu bekommen, muss ein Süchtiger die Scham, die ihn schützt, überwinden - sonst würde er sich selbst zerstören.
Das ist in der Tat ein Paradox. Man könnte auch sagen, es ist eine Tragödie. Ich muss diese Schamgrenzen überwinden, um mich zu retten. Und ich muss meine eigenen Grenzen erkennen und verstehen. Eine Grenze hat aber auch etwas Verbindendes. Wenn ich an eine Grenze komme, bin ich auf andere angewiesen. Wenn ich sage: "Ich kann das nicht. Ihr müsst mir helfen", habe ich mich entlastet und zugleich einen sozialen Kontakt hergestellt. Diesen Gewinn zu spüren ist für jeden etwas Wunderbares.
Lässt sich der Schritt erleichtern?
Man kann versuchen, sich der eigenen Schamgrenze langsam zu nähern, Worte und eine Sprache zu finden, vielleicht auch erst einmal in einer anonymen Beratung. Viele rufen bei der Telefonseelsorge an, weil sie dabei nicht gesehen werden können. Dadurch wird die Schamschwelle etwas gemildert, aber nicht beseitigt. Für den Telefonseelsorger ist es wichtig, diese Grenze zu erkennen und nicht selbst zu überschreiten, um den Anrufer nicht zu beschämen. Stattdessen kann er Angebote machen, den Schritt selbst zu gehen, zum Beispiel indem er sagt: "Ich kann mir vorstellen, dass man sich für etwas schämt."
Sie leiten Seminare zum Thema Scham und Schuld für Telefonseelsorger. Was möchten Sie vermitteln?
Mir ist wichtig, dass die Teilnehmer Scham und Schuldgefühle als etwas ganz Normales begreifen, das jeder in sich hat, und dass sie sich ihrer eigenen Schamgeschichten bewusst werden. Wenn man in der Gruppe von einer Situation erzählt, in der man sich sehr geschämt hat, erfordert das Mut. Man bekommt schweißnasse Hände, wird rot oder will sich verweigern. Gleichzeitig macht man die Erfahrung, wie befreiend es sein kann, etwas erzählt zu haben, was man seit Jahren mit sich herumträgt. Man wird eben nicht abgelehnt, sondern bekommt im Gegenteil Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und das ist für manchen eine sensationelle Erfahrung. Telefonseelsorger sollten einmal am eigenen Leib gespürt haben, was für eine harte Arbeit es ist, zum Telefonhörer zu greifen und etwas zu erzählen, wofür man sich schämt. Sie lernen, dass es keine prinzipiellen, nur graduelle Unterschiede zwischen Anrufer und Seelsorger gibt. Das gilt meiner Meinung nach übrigens grundsätzlich: Jeder Mensch hat eine Suchtstruktur und schämt sich dafür. Der eine stopft Essen in sich hinein, der andere trinkt zu viel, der nächste schaut exzessiv fern. Mich hat der Satz der Anonymen Alkoholiker beeindruckt: "Wen Gott liebt, den lässt er Alkoholiker werden." Er drückt die Befreiung aus, die dadurch entsteht, dass man zu seiner Abhängigkeit und damit zu seiner Begrenztheit steht und trotzdem seine Würde behält. Dann kann man entspannt leben ohne Suchtmittel.
Kann man Scham mindern?
Ja, indem man das Selbstgefühl stärkt, indem man sich klarmacht, welche Werte man verinnerlicht hat und sich fragt: Woher kommen die? Wer hat mir eigentlich gesagt, dass ich schnell und schön und klug und immer der Beste sein muss? Angehende Telefonseelsorger lernen, wie wichtig es ist, dass sie ihr Gegenüber positiv bestärken und damit sein Selbstwertgefühl aufbauen. Wenn jemand viele Probleme hat und nicht weiß, wo er anfangen soll, erzähle ich vom Fluss mit den Baumstämmen, die sich darin verfangen haben und das Wasser stauen. Das Bild stammt von dem Psychoanalytiker Michael Balint. Er meinte, es komme in einem solchen Fall nicht darauf an, alle quer liegenden, in sich verkeilten Baumstämme aus dem Fluss zu ziehen, sondern nur darauf, den einen zu finden, der alle anderen blockiert, den zu entfernen und im Übrigen den Fluss seine Arbeit tun zu lassen. Es geht darum, wieder in Gang zu kommen, die Scham so weit zu mindern, dass die Menschen wieder handlungsfähig werden.
Suchtkranke schämen sich auch, weil sie andere verletzt und vernachlässigt haben. Sie fühlen sich schuldig.
Schuld ist die Wächterin meiner Sozialfähigkeit. Schuldgefühle warnen mich: Wenn ich so weitermache, bin ich nicht mehr gesellschaftsfähig. Schuld wird oft verdrängt. Süchtige müssen darüber sprechen, was sie verschuldet haben. Bevor das Thema behandelt und verhandelt wurde, ist eine Suchttherapie im Grunde nicht beendet. Das ist für die Betroffenen nicht leicht, weil sie mit denen sprechen müssen, an denen sie schuldig geworden sind und deren Vergebung oder Entschuldigung sie brauchen. Damit ist kein Lippenbekenntnis gemeint, sondern eine ehrliche, ernst gemeinte Bitte. Wenn es um etwas Großes geht, ist das sehr hart. Nicht in jedem Fall nimmt die Entschuldigung die Schuld. Auch diese Erkenntnis gehört dazu: etwas getan zu haben, was vielleicht nicht wieder gut zumachen ist.