Am Anfang war die Idee. Unsere Idee von der Welt. Wir wissen genau, wie die Erde aussieht und wie sie zu dem geworden ist, was wir heute sehen. Der Haupt Verlag wirft mit zwei Neuerscheinungen aus diesem Herbst ein Licht auf das Dunkel dieser unserer festen Überzeugungen.
Denn Geschichte wurde und wird, auch wenn wir sie immer wieder wie absolutes Wissen behandeln, von den Siegern und Eroberern geschrieben – und das Gleiche gilt in erstaunlichem Maße für Geografie. Die Aufklärung über den Kolonialismus, seine Folgen und die immensen Lücken in unseren Schulbüchern vermögen bislang den Fokus stückweise zu verschieben und erzeugen zum Teil neue Ambivalenzen. Umso spannender ist es also, sich in zwei Werke zu vertiefen, die anhand eher "unverfänglicher" Sachthemen unsere Wege durch und über diese Welt nachzeichnen. Und unsere die Erde transformierende Macht, sei es zum Gewinn, zum Fortschritt oder zur Zerstörung.
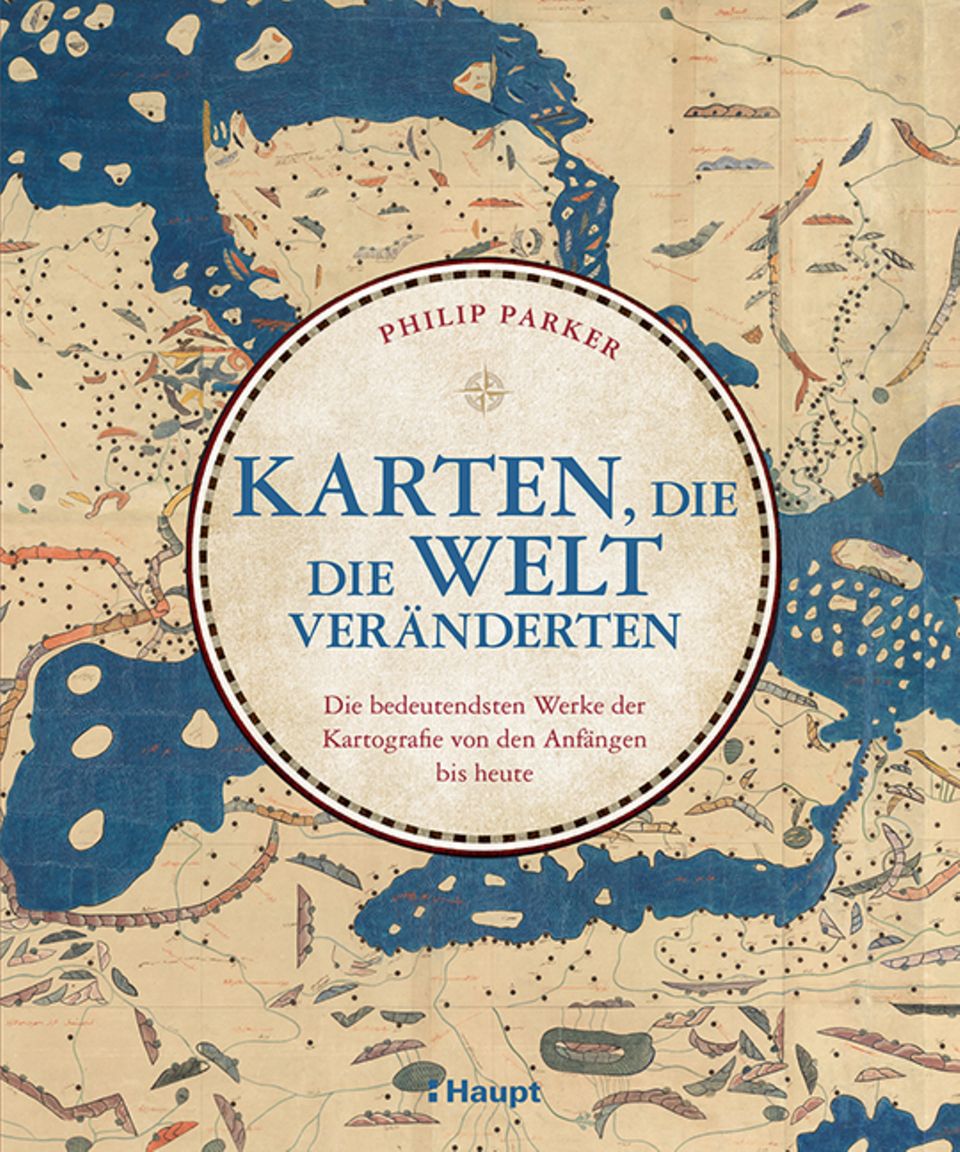
Zunächst zur Geographie
"Karten, die die Welt veränderten" nennt Philip Parker seinen Band über Atlanten und Globen von der Frühzeit bis zu den digitalen Karten auf unseren Smartphones – und trifft mit diesem Titel den Kern der Sache: Seit ihren Anfängen wurde die Welt nicht nur aus Erkenntnisinteresse vermessen, um Reise- und Handelsrouten festzuhalten und astronomische Orientierung zu bieten. Karten sollten auch Herrschafts- und Machtregionen markieren, dienten der Geschichtsdeutung und sogar der religiösen Verortung. Parker illustriert dies mit zahlreichen Beispielen, die etliche Überraschungen bereithalten und uns noch einmal anders auf aktuelle Debatten schauen lassen.
So stammt die heutige Praxis der genordeten Karten aus der arabischen Kartographie, während die europäische Tradition zumeist den Osten oben platzierte. Nicht ohne den Garten Eden oder andere mythische Orte mit zu verzeichnen – ein Abbild der Welt war und ist immer auch ein Bild dessen, was den sie Vermessenden, den Auftraggebenden und Nutzenden der Karten wichtig ist. Wissenschaft, so wird beim Verfolgen all der Routen über Land und Ozeane deutlich, ist nicht absolut, sie ist Irrtümern sowie erneuten Versuchen unterworfen und lernt genau daraus. Wie lässt sich eine dreidimensionale Welt auf zweidimensionalen Unterlagen darstellen? Welche Verzerrung muss dafür gewählt werden, und wie kann diese deutlich gemacht werden, um ein möglichst genaues Bild zu erreichen und zu verstehen, dass das Dargestellte zugleich nur eine Annäherung ist? Dass die Lücken unserer Erkenntnis stets größer sind, als wir vermuten. Dass andere vielleicht schon kartiert haben, was wir eben erst entdecken – so wie koreanische Karten bereits im Mittelalter Details der afrikanischen Ostküste abbildeten, als Europäer noch versuchten, sich einen Überblick zu verschaffen.
So wurde die Welt gewichtet
Parker nimmt uns mit auf eine Reise durch sein immenses Wissen über Herstellungsmethoden von Atlanten seit der Antike bis heute; er stellt uns Personen vor, die die Vermessung und Kartographie nachhaltig veränderten, erzählt Welt-Geschichte in neuer Weise anhand von Karten, die auf dem Kopf zu stehen oder zu rotieren scheinen, von Karawanen durchzogen werden, die historische Ereignisse illustrieren und verknüpfen und die je nach Fokus Dinge auslassen oder hervorheben. Er zeigt uns, wie medizinische Topografie im 19. Jahrhundert half, eine Cholera-Epidemie in Schottland und London zu verfolgen und zu bekämpfen, und soziodemografische Karten wie der Poverty-Atlas Probleme genauer sichtbar und behandelbar machen.
"Karten, die die Welt veränderten" ist ein gewichtiger Band, der eher etappenweise als an einem Stück zu lesen ist. Dabei bietet er, ergänzt durch die reichhaltige Auswahl an Illustrationen und Karten aus allen Epochen, eine äußerst anregende Lektüre: Parker würzt seine Schilderungen mit zahlreichen Anekdoten und einer erfrischenden Sprache, die en passant Aha-Effekte über die Herkunft scheinbar geläufiger Begriffe erzeugt und den Wortschatz des Lesers mit schönen, fast vergessenen Ausdrücken erweitert. Letzteres ist sicher mindestens ebenso der Übersetzerin Susanne Schmidt-Wussow anzurechnen, deren beeindruckende Leistung hier unbedingt gewürdigt werden muss.
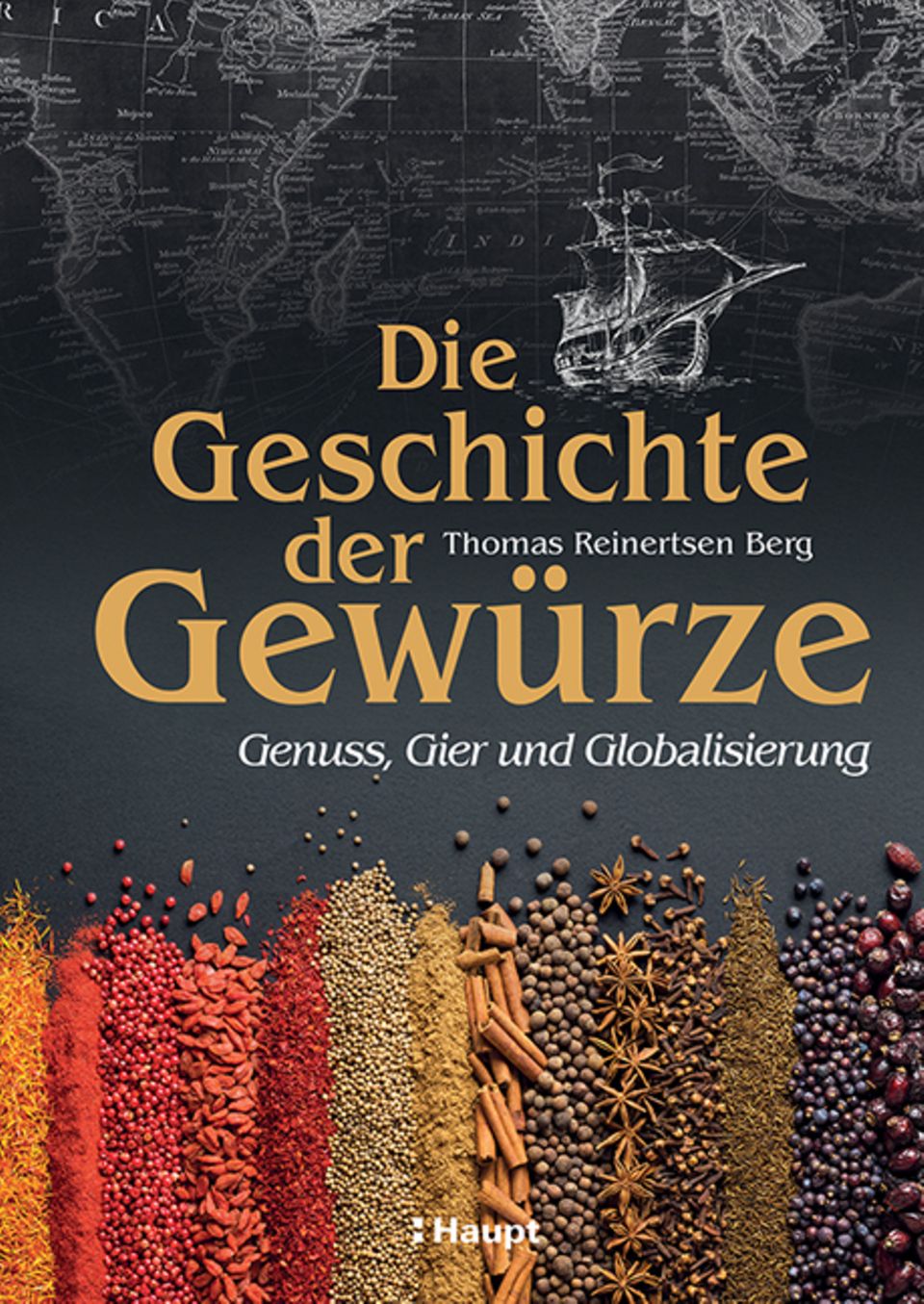
Und nun zum Geschmack der Welt
Natürlich trieben auch militärische, imperiale, nationalistische und koloniale Zwecke die Kartographie voran. Und vor allem Handelsinteressen. Über "Genuss, Gier und Globalisierung" schreibt Thomas Reinertsen Berg in seiner "Geschichte der Gewürze", die eine ähnliche Welt-Reise unter anderem Fokus unternimmt. Pfeffer, Muskat, Nelken und Zimt sind aus unserer Küche heute nicht wegzudenken – doch ihr Weg zu uns ist ebenso spannend wie schmerzhaft.
In anekdotischem, leicht mäanderndem Stil erzählt Reinertsen Berg von chinesischen Dichtern, ägyptisch-griechischen Händlern und Archäologen aus Italien und den USA, die eine Spur seltener Gewürze über die Jahrhunderte verfolgten und bezeugten. Er stellt die Pflanzen selbst vor und lässt uns in Gedichten, Briefen und Illustrationen die Faszination, die ihre Früchte, Blütenknospen und Samen seit jeher auf Menschen ausüben, ganz neu schmecken – und die Fragilität ihrer Lebensbedingungen spüren, denn viele dieser Pflanzen gedeihen nur auf ganz bestimmten Böden sowie unter bestimmten klimatischen Voraussetzungen.

Es entstanden Plantagen und Monokulturen
So gab es Muskat beispielsweise ausschließlich auf den Banda-Inseln, und frühzeitig begannen asiatische und europäische Mächte, diese Inseln zu suchen und den eigenen Einflusssphären zuzuschlagen. Wo vordem friedlicher Handel auf Vertrauensbasis geblüht hatte und wild wachsende Bäume nach Bedarf abgeerntet wurden, entstanden ausgedehnte Plantagen und Monokulturen. Die Bewohner der Regionen wurden von Handelspartnern zu abhängigen Arbeitern oder Widersachern. Oder sogar selbst zur Ware.
Den Kampf um die koloniale Aufteilung der Welt führte dabei nicht nur der Westen. Auch Ägypten und etwa Oman nahmen daran teil und sicherten sich Land und Handelsrouten für Gewürze und Sklavenhandel in der Südsee und in Ostafrika. Auf der Jagd nach seltenen Pflanzen und Rohstoffen eroberten europäische Mächte die Gewürzinseln und andere fruchtbare Regionen, führten Kriege in fremden Weltmeeren, unterjochten lokale Bevölkerungen bis zum Völkermord und zerstörten vielerorts die Natur, von der sie profitieren wollten. Der Zyklus von Überproduktion und künstlicher Verknappung zur Preisregulierung ist jahrhundertealt und hat tiefe Spuren in den Landschaften der Gewürzregionen hinterlassen.
Niedrige Preise durch schwache Arbeitnehmerrechte
Was Reinertsen Berg mit einer nahezu märchenhaften Beschreibung der Entstehung von Vulkaninseln und Zimtkassienwälder begann, beendet er mit der Frage nach Wegen zu einem gerechten Handel. Denn weitgereiste Gewürze sind heute kein Statussymbol mehr, sondern für jeden von uns erschwinglich. Doch die Kehrseite dieser Demokratisierung des Konsums in Europa sind wie so oft Produktionsweisen in den Herkunftsregionen, welche die niedrigen Preise mit schwachen Arbeitnehmerrechten und umweltschädlichen Agrarmethoden erwirtschaften. Zugleich sind die Inseln besonders gefährdet: Der Meeresspiegel steigt in Asien schneller als im Weltdurchschnitt. Der Zusammenhang von "Genuss, Gier und Globalisierung" ist ein historisches Phänomen wie auch eine ganz aktuelle Frage an unser Konsumverhalten.
Bei alldem lässt "Die Geschichte der Gewürze" den Genuss nicht zu kurz kommen. Das Buch ist liebevoll gestaltet mit einer vielfältigen Auswahl von Illustrationen und Faksimiles, die verschiedene kulturelle, biologische, kulinarische und geschichtliche Bezüge der Suche und Sucht nach Gewürzen unterstreichen. Getrübt wurde das Lesevergnügen der Rezensentin nur durch den etwas mäandernden Stil des Autors, der das Nachvollziehen mancher Erzählstränge ein wenig schwierig machte. Hier hätte, wie auch mit Blick auf Syntax und Grammatik, dem Buch ein Lektorat gutgetan, auf das der Verlag aus unerfindlichen Gründen und mit merklichen Folgen verzichtet hat.
Was beide Bücher vereint
So unterschiedlich die roten Fäden, so ähnlich sind sich die beiden Bände in ihrer breiten Perspektive und den Erzählweisen, die den Leser unterhaltsam und informativ über Epochen führen, indem sie Anekdotisches mit Historischem und Wissenschaftlichem verbinden und dabei großes Detailwissen versammeln. Gemeinsam ist ihnen auch, dass die Bedeutung derer, die Autoren hinter den Kulissen unterstützen, hier besonders sichtbar wird, sei es im spürbaren Fehlen eines Lektorats oder in einer exzellenten Übersetzung. Nicht zuletzt profitieren beide von einer großartigen Bildauswahl und sehr ansprechenden Gestaltung – eine Spezialität des Haupt Verlags.
Die Bücher seien allen empfohlen, die neugierig sind und Lust auf vielschichtige Anregungen haben. Und allen, die noch ein Geschenk suchen. Immerhin beginnt gerade die Saison von Zimt und Nelken. Eine Saison, in der wir hoffentlich auch Zeit haben, die Welt und unsere Bilder von ihr mit neuen Augen zu betrachten.










