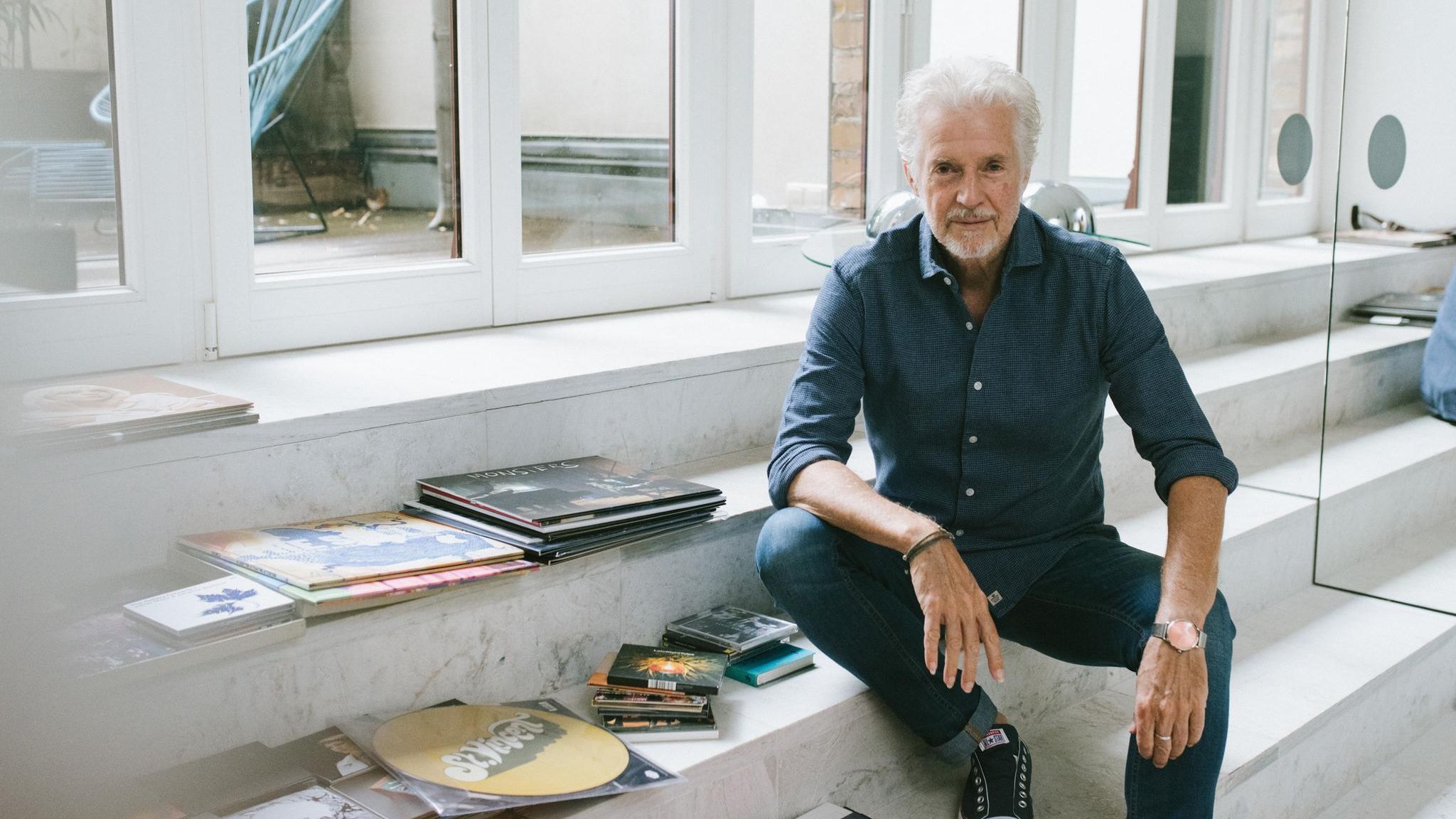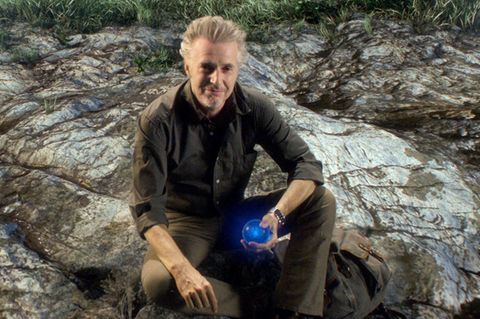Stern plus
Jetzt testen
Zugang zu stern+
statt 11,96 € nur 1 €
- Alles von stern+ mit erstklassigen Inhalten von GEO und Capital
- 4 Wochen testen, dann 2,99 € je Woche
- jederzeit kündbar
Bereits registriert?