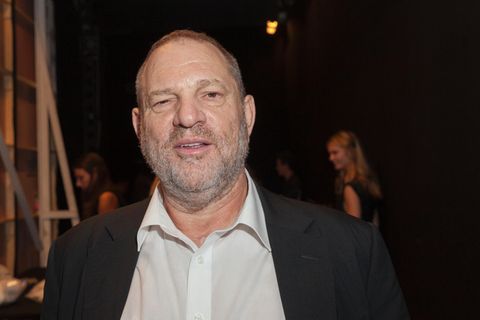Der Steuerbeamte Harold Crick hört plötzlich eine fremde weibliche Stimme in seinem Kopf. Klar und deutlich beschreibt sie seine tägliche Routine, von der Anzahl der Bürstenstriche beim Zähneputzen bis zur Zahl der Schritte zur Bushaltestelle. Vollends in Panik gerät der unscheinbare Bürohengst, als die kleine Frau im Ohr seinen nahen Tod erwähnt. Doch die exzentrische Komödie "Schräger als Fiktion" hält für Harolds Not eine unorthodoxe Erklärung parat.
Nach erfolglosen Psychiaterbesuchen versucht es Harold nämlich mit einem Literaturspezialisten. Und Professor Hilbert stellt nach einer kurzen Stilanalyse der allwissenden Kopfstimme fest, dass Harold nicht etwa an Schizophrenie leidet, sondern eine unvollendete literarische Erfindung ist. Hilbert kann sogar Harolds Schöpferin identifizieren, eine berühmte, untergetauchte Schriftstellerin, die seit zehn Jahren an dem Roman "Tod und Steuer" schreibt. Da ihre Helden allesamt sterben, muss Harold sie unbedingt finden, bevor sie ihn und den Roman beendet.
Kaninchenlöcher in der Realitätsebene
Denn nachdem sich Harold in Steuerschuldnerin Ana verliebt hat, erscheint ihm sein graues Dasein überaus lebenswert. Philosophisch verschwurbelte Existenz-Komödien mit Helden, in deren Alltag sich wie bei "Alice im Wunderland" unversehens Kaninchenlöcher in andere Realitäts-Ebenen auftun, sind in Hollywood seit längerem in Mode. So entdeckte in der "Truman Show" der Held, dass sein Leben eine Fernseh-Fälschung ist, und in "Being John Malkovich" wurden Führungen durch Schauspielerhirne unternommen. Dem deutschen Regiestar Marc Forster, der unter anderem den Oscar-Gewinner "Monster's Ball" drehte, ist nun die bis jetzt eingängigste und possierlichste Erleuchtungs-Komödie gelungen, intelligent um die Ecke gedacht und frei von artifiziellem Fantasy-Gedöns.
Man muss nur akzeptieren, dass der Film sein eigentliches Rätsel, die Fleischwerdung des Buchstabenwesens Harold, nicht mal ansatzweise erklärt. Oder dass der Faden zwischen Marionette Harold und seiner Puppenspielerin zeitweise reißt. Auch kann sich Autorin Kay Eiffel, die wie alle Personen nach Mathematikern benannt ist, mit ihrem verzweifelten Geschöpf, das sie mit wenigen Tastenschlägen ihrer Schreibmaschine töten könnte, ganz ohne Special-Effects-Budenzauber im Hier und Jetzt treffen. Die minimalistische Kulisse - gedreht wurde vor den monoton gerasterten Fassaden der Chicagoer Bauhaus-Architektur - wirkt ohnehin wie ein surreal verrutschtes Niemandsland.
Dustin Hoffman als professoraler Kauz
Als Gegengift zum Terror des rechten Winkels erscheint die sinnlich-renitente Keksbäckerin Ana (eine total niedliche Maggie Gyllenhaal), mit der das Eckige ins Runde findet. Altstar Dustin Hoffman als professoraler Kauz diskutiert Harolds Dilemma mit solch komischer Ernsthaftigkeit, dass die Absurdität der Situation nebensächlich wird. Riesenbaby Will Ferrell, sonst der König der Klamotte, steckt im grauen Anzug wie in einer Zwangsjacke und kann im Star-Ensemble mühelos mithalten. Mit stoischem Gesicht und leicht gestauchter Haltung unterspielt der Komiker die Verwirrung seines sanftmütigen Helden, der sich auf der Bühne seines Lebens von der Souffleuse emanzipieren und improvisieren muss.
Den Vogel schießt jedoch die unvergleichliche Emma Thompson als verstrubbeltes, kettenrauchendes Nervenbündel ab. Als neurotische Schicksalsgöttin, von Schreibblockade und Abgabetermin geplagt, bekommt sie in dieser mit spitzfindigen Dialogen ohnehin gesegneten Komödie die sarkastischsten Pointen gewährt. Wird sie Harold im Namen der Kunst opfern? Oder lässt sie sich für ein literarisch verpöntes Happy End erweichen? Klar, dass solche Probleme besonders Menschen interessieren, die selbst ab und zu zum Buch greifen. Diesen dürfte die gefinkelte Komödie über Leben, Tod und Literatur ungeheuer Spaß bereiten.