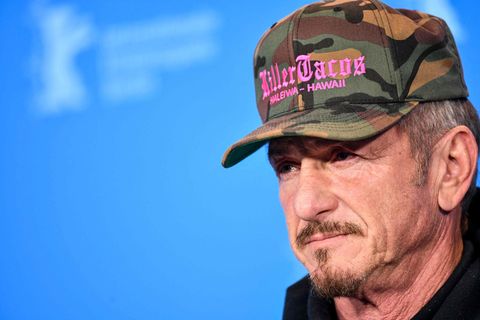Da war es mal wieder, dieses schizophrene Festival-Gefühl. Auf der einen Seite sitzt man als Kino-Afficionado hier wie die Made im Speck, kann Filme gucken, bis einem der Kopf wie ein Projektor surrt. Auf der anderen ist es aber kaum möglich, das Gesehene anschließend mit gebührender Ruhe auf sich wirken zu lassen und zu verarbeiten. Kaum läuft der Abspann, rumpeln die ersten Kollegen schon mit ihren Berlinale-Satteltaschen aus dem Saal, im Foyer herrschen Zustände wie beim Untergang der Titanic und draußen auf dem überfüllten Potsdamer Platz läuft man auf dem Weg zur nächsten Pressekonferenz, zum nächsten Film oder nächsten Empfang sekündlich Gefahr, über den Haufen gerannt zu werden.
Logischerweise tritt dieses Gefühl nur dann auf, wenn es auch wirklich etwas zu wirken und verarbeiten gibt. Im Fall des mexikanischen Wettbewerbsbeitrages "Lake Tahoe" gab es das auch, was sich aber eher auf das Schlafdefizit wegen vorherigen kurzen Nacht bezog. Doch sogar nach zwölf Stunden Bettruhe hätte man sich gerne eins dieser hübschen roten Berlinale-Kissen herbeigewünscht, um das Einnicken komfortabler zu gestalten. Fernando Eimbckes Film schildert uns, was so alles passieren kann, wenn man als 16-Jähriger vom kürzlichen Tod des Vaters, der vor sich hin dämmernden Mutter und des vernachlässigten kleinen Bruders gebeutelt ist, mit dem Familienauto abhaut und die Kiste dann gegen einen Telegrafenmast setzt. Die folgenden 80 Minuten verbringt der Junge damit, ein Ersatzteil für seinen Wagen aufzutreiben, was in einigen wenigen Momenten absurd-amüsant, die meiste Zeit aber von Langatmigkeit und etwas gespreizter Inszenierung bestimmt ist.
Atemberaubende Uneitelkeit bei Tilda Swinton
Ein ganz anderes Kaliber hingegen sind die beiden Konkurrenten "Julia" und "Gardens of the Night". Ersterer erinnert an John Cassavetes Klassiker "Gloria" (1980), in dem sich Gena Rowlands als Gangsterbraut plötzlich die Ersatzmutter für einen kleinen Jungen geben musste. In der Variante des Franzosen Erick Zonca ist die Titelfigur eine Alkoholikerin, die sich nach einem schief gegangenen, fingierten Kidnapping mit dem zehnjährigen Milliardärsenkel Tom auf der Flucht im amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet wieder findet. Obwohl mit 138 Minuten vielleicht etwas zu lang geraten, fesselt die Fusion aus Psychogramm und Thriller, was ausschließlich an der herausragenden Tilda Swinton liegt, die sich radikal von ihrem Image als ätherisches, überirdisches Wesen früherer Derek Jarman- und Sally Potter-Filme löst und mit atemberaubender Uneitelkeit die wohl packendste Vorstellung einer Trinkerin absolviert, die es je im Kino zu sehen gab. Absolut Preisverdächtig. Und extra dafür anreisen müsste sie auch nicht. Sie nimmt kommende Woche einen Ehren-Teddy für ihre Arbeit mit dem 1994 verstorbenen Jarman entgegen, den Regisseur Isaac Julien in der Panorama-Dokumentation "Derek" porträtiert hat.
Schockierendes Thema ohne Leidenskitsch
Kinder stehen auch in "Gardens of the Night" im Mittelpunkt. Und durchleben die Hölle. Mit der Behauptung, ihre Eltern seien tot bzw. psychisch krank,"kümmern" sich zwei Männer um die achtjährige Leslie und den gleichaltrigen Donnie, internieren sie in ihrem Haus, um sie an Pädophile zu vermieten. Über mehrere Jahre dauert dieses Martyrium an, und als Ergebnis davon fristen die beiden verkrüppelten Seelen später als Teenager ein trostloses Leben auf dem Strich und in den Straßen San Diegos. Am Schluss scheint sich zumindest für Leslie ein Entkommen aus dieser Tristesse abzuzeichnen, als ihr der von John Malkovich gespielte Leiter einer Herberge für Problemkinder erzählt, dass ihre Eltern noch leben. Doch die Frage ist nur, ob bei ihrem Grad psychischer Zerstörung überhaupt ein Happy End möglich ist. Dem britischen Regisseur Damian Harris gelingt das große Kunststück sich seinem schockierenden Thema ohne Leidenskitsch und Voyerismus, dafür nüchtern und sensibel zugleich zu nähern. Und mit Ryan Simpkins und Gillian Jacobs kann die Berlinale gleich zwei Entdeckungen in derselben Rolle feiern.
Schnell wieder auf die Euphoriebremse getreten und übergeleitet zum Panorama-Beitrag "Transsiberian", weil der Regisseur Brad Anderson heißt und vor vier Jahren den abgemagerten Christian Bale als "The Machinist" auf einen brillianten Paranoia-Trip geschickt hat. Nun versucht er sich an einem Thriller klassischen Hitchcock-Musters. Ein nettes amerikanisches Ehepaar (Woody Harrelson, Emily Mortimer) gerät auf seiner Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn an ein Drogenschmuggler-Pärchen und damit in einen mörderischen Alptraum, der im Folterbunker eines korrupten, russischen Polizei-Offiziers (Ben Kingsley) seinen Höhepunkt findet. Klingt kurzweilig, kommt aber so schwerfällig in Gange wie die Lokomotive des titelgebenden Verkehrsmittels. Statt wie der große Meister der Suspense auf Tempo und psychologische Raffinesse zu setzen, lähmt Anderson seine Geschichte immer wieder mit zähflüssigen Dialogpassagen, damit auch wirklich keine Nische der Figuren unausgeleuchtet bleibt. In diesem Genre ist der Protagonist nur das, was er tut, da scheinen sich der Regisseur und sein Co-Autor wohl im Abteil geirrt zu haben. Immerhin: der Auftritt von Thomas Kretschmann als Kingsleys maulfauler Mann fürs Grobe hat einen doppelten Wodka verdient.
Kommt Julia noch?
Den könnte mittlerweile auch Berlinale-Boss Dieter Kosslick vertragen. Da präsentiert sich das Festival zum ersten Mal seit gefühlten 20 Jahren unter blauem Frühlingshimmel bei milden Temperaturen, und ihm verweigern sich die Stars. Nach der Absage der beiden Jurorinnen Sandrine Bonnaire und Susanne Bier, wird nun auch John Malkovich nicht kommen. Und während der DAX sich inzwischen leicht erholt zeigt, sinkt der KOMJUNOX (Kommt Julia noch Index) stetig. Glaubt man dem Parkett-Geflüster rund um den Potsdamer Platz, sollte man besser keine Roberts-Aktien kaufen.
Lieber eine Tafel exklusive, handgeschöpfte Berlinale-Bio-Schokolade mit 70 Prozent Kakao. Gibt's im Festival Shop. Und ist besser für Nerven. Hilft aber nicht gegen Schizophrenie.