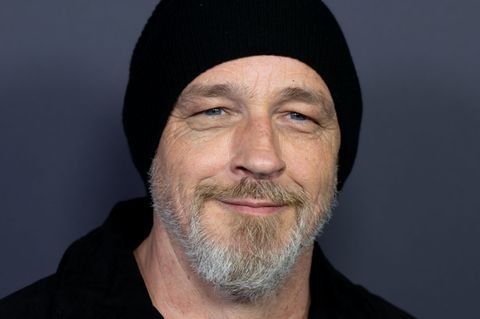Kaum ein Künstler der Moderne ist häufiger kopiert worden als er. Millionenfach finden sich Motive seiner Werke auf Tellern und Tassen, Schreibutensilien, T-Shirts, Uhren, Aschenbechern oder Kalendern. Auch die Werbung hat ihn schon längst für sich entdeckt. Seit den 80er Jahren nutzt das französische Unternehmen L'Oreal erfolgreich die abstrakten Bildkompositionen für seine berühmte Haarpflegeserie. Ein Wiedererkennungseffekt, der für eine klare Linie steht: Die Frisur sitzt perfekt. Die unverkennbaren Motive haben sich auch in der Mode durchgesetzt. Bereits 1965 hat Yves Saint Laurent eine eigene Kollektion entworfen, die den "Dialog mit der Kunst" suchte. Der Modeschöpfer hielt sich dabei streng an die eigenwilligen Vorgaben des Urhebers. Kunst, die damals noch die Welt schockierte, ist heute zur ständigen Inspirationsquelle für Grafiker, Designer und Werber geworden.
Wie gut, dass der holländische Maler Piet Mondrian nicht mehr erleben muss, wie sein "Weltdurchdringungsblick" von der Industrie umgedeutet wird. Mit seinen roten, gelben und blauen Rechtecken, die von schwarzen geometrischen Linien umrandet sind, zählt Mondrian zu den bedeutendsten und einflussreichsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Doch wer hat das Werk des Malers wirklich verstanden?
Das Kölner Museum Ludwig zeigt ab dem 14. Dezember 2007 bis zum 30. März 2008 mal eine ganz andere Seite des Malers. Die Ausstellung "Piet Mondrian - Vom Abbild zum Bild" präsentiert den Künstler in seiner ganzen Vielfalt. Mit achtzig Bildern und Zeichnungen gastiert am Rhein eine der weltweit größten und bedeutendsten Mondrian-Sammlungen aus dem Gemeentemuseum in Den Haag. Hier sind auch die frühen Bilder Mondrians zu sehen, die wesentlich zur Entwicklung seines künstlerischen Schaffens beigetragen haben. Schwerpunkt der Ausstellung ist der künstlerische Prozess, den der Maler auf dem Weg zur Abstraktion durchlief.
Europäisches Networking im besten Sinne
Piet Mondrian wurde am 7. März 1872 im niederländischen Amersfoort geboren. Von 1886 bis 1872 ließ er sich zum Zeichenlehrer ausbilden und studierte dann an der Amsterdamer Akademie. Ende des 19. Jahrhunderts war Mondrian eher als Landschaftsmaler bekannt, seine Gemälde aus dieser Zeit sind von der Schule von Barbizon beeinflusst, einer französischen Künstlerkolonie am Wald von Fontainebleau. Beliebte Motive waren zunächst Bäume und Mühlen, welche in ihrer Form jedoch gestrafft und vereinfacht wirkten. Seine frühen Werke sind noch stark von den Stilen dieser Zeit geprägt, vom Impressionismus, Symbolismus, später auch Kubismus, dass ein Laie sie heute auf den ersten Blick gar nicht unmittelbar dem Künstler Mondrian zuordnen würde.
1912 begegnete Mondrian den beiden Franzosen George Braque und Pablo Picasso, die ihn mit dem analytischen Kubismus bekannt machten und seinen Weg in die Abstraktion lenkten. Gemeinsam mit Theo van Doesburg gründete er 1917 die "De Stijl"-Gruppe um die gleichnamige Trend-Zeitschrift. "De Stijl" war ein europaweit agierendes Forum und keine feste Gruppe. Neben dem eigentlichen niederländischen Kreis um Mondrian, van Doesburg, Gerrit Rietveld und Jacobus Johannes Pieter Oud publizierten dort auch russische Konstruktivisten wie El Lissitzky, italienische Futuristen wie Gino Severini und deutsche Dadaisten wie Kurt Schwitters und Hans Arp. Europäisches Networking also im besten Sinne.
Geschwungene Linien waren ihm zu sinnlich
In den ersten zwölf Ausgaben des Magazins "De Stijl" veröffentlichte Mondrian seine programmatische Schrift "De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst" ("Die neue Gestaltung in der Malerei"), in der er seine künstlerische Theorie zur Malerei unter dem Begriff "Neoplastizismus" erläuterte. Ab 1920 konzentrierte er sich in seiner Malerei auf abstrakte Konstruktionen aus Horizontalen und Vertikalen, deren Flächen er durch den Einsatz der Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie der Nichtfarben Schwarz, Weiß und Grau gliederte. 1940 wanderte er in USA aus und starb in New York am 1. Februar 1944 an einer Lungenentzündung.
Die Ausstellung
"Piet Mondrian - Vom Abbild zum Bild"
14. Dezember 2007 bis 30. März 2008
Museum Ludwig, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln
Di - So, 10-18 Uhr, jeden 1. Freitag im Monat 10-22 Uhr
Dass Piet Mondrian nicht als "Neoplastizist" geboren wurde, sondern über viele Umwege erst mit annähernd 40 Jahren zu seiner "Linie" fand, wird in der Kölner Schau äußerst eindrucksvoll dargestellt. Mondrian versuchte mit seinen Bildern die universale und absolute Schönheit darzustellen. Und verzichtete bewusst auf repräsentative Elemente, weil die, wie er meinte, subjektive Empfindungen hervorrufen könnten. Er arbeitete durchweg mit geraden Linien, weil es ihm nur auf Funktionalität und Sachlichkeit ankam. Geschwungene Linien dagegen waren ihm viel zu sinnlich.
Die Gegenüberstellung seiner nur selten gezeigten großformatigen Zeichnungen mit seiner späteren Malerei macht anschaulich deutlich, wie er von der Naturstudie zur Abstraktion gekommen ist. Wie er schon in seinen impressionistischen Arbeiten langsam Flächen und Farben komponierte, die er später immer radikaler reduzierte. Bis er schließlich nur noch streng geometrisch malte - und diese Werke zu Ikonen der Moderne machte. "Das Erleuchten der Menschheit durch Schönheit und Reinheit" war sein erklärtes Ziel.
"Nur auf die klarste und stärkste Weise"
Selbstverständlich sind in Köln auch die berühmten Mondrian-Kompositionen aus roten, gelben und blauen Rechtecken zu sehen. Mit den drei Primärfarben rot, gelb und blau und den drei neutralen Farben weiß, schwarz und grau und den horizontalen und vertikalen Linien symbolisiert er die Harmonie zwischen Gegensätzen, zum Beispiel denen zwischen Mann und Frau, dem Individuum und der Gesellschaft oder dem Spirituellen und Materiellen.
Der Niederländer führte die Bildarchitektur des Kubismus zur letzten Ausformung einer modernen Klassik. Und hat sich damit in der Kunstgeschichte einen unauslöschlichen Namen als "Bahnbrecher", als "Bilderstürmer" der abstrakten Malerei gemacht. Konsequent und diszipliniert hat er sich seinem eigenen künstlerischen Arbeitsprozess unterworfen: "Was will ich mit meinem Werk ausdrücken? Schönheit auf der ganzen Linie und Harmonie durch das Gleichgewicht der Beziehungen zwischen Linien, Farben und Flächen zu erreichen. Aber nur auf die klarste und stärkste Weise."
Das ist ihm gelungen. Bis heute.