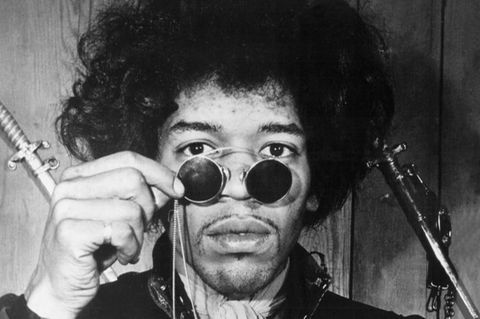Mit seinen 23 Jahren ist Adam Green ein Experte der Beat Generation. Die Werke von William Burroughs, Allen Ginsberg und Jack Kerouac hat er vor gerade mal vier Jahren entdeckt und zum Maßstab für sein eigenes dichterisches Schaffen gemacht. Unbekümmert verbindet er nette Melodien mit bissigen Texten, auf seinem gerade erschienenen zweiten Album "Gemstones" (Rough Trade) noch freier und frecher als auf dem von der internationalen Kritik gefeierten Debüt "Friends of Mine". Im Februar kommt er auf Deutschland-Tournee.
Bei Green reimt sich Vagina auf Carolina; um einen Text zu "würzen" streut er gezielt Flüche und andere Worte ein, die seinem Album in den USA den Aufkleber mit dem "Parental Advice" einbringen. "In den Staaten wird es den bekommen", so Green. "Sobald man zwei oder drei Flüche sagt, hat man den. Ich habe es schon lange aufgegeben, ihn zu vermeiden. Das verhindert, das mein Album in gewissen Läden ins Regal kommt und verärgert ein paar Leute, die Musik zu ernst nehmen."
"Alles kann in einem einzigen Lied passieren"
Was nicht heißen kann, dass er seine Musik nicht ernst nimmt. Green spielt mit Bedeutungen, mit Tempo- und Rhythmuswechseln und Melodien, und zwar nach seinen eigenen Regeln. "Ich benutze ein Wort, um eine Absicht auszudrücken und manchmal Flüche, um ein Lied etwas zu schärfen. Ich schreibe Lieder unter der Prämisse, dass es okay ist, fünf bis sechs Empfindungen darin zu haben. Ich denke, es ist nichts falsch daran, mit etwas Tragischem zu beginnen und es dann in etwas Romantisches zu verwandeln. Oder etwas Humoriges zu nehmen und es in etwas Politisches zu wenden. Ich glaube, dass das alles in einem einzigen Lied passieren kann. Es ist genau dieser Kontrast, der Tiefe und Realismus hat; so geht es ja auch im wirklichen Leben zu. Das kommt von vielen verschiedenen Seiten, und ich denke, die Leute mögen das. Ich denke, die Leute haben keinen Bock mehr auf das flache Zeug."
Von einem Talentsucher entdeckt
Dass er seine surrealen Texte in hübsche Folkmelodien verpackt, ist der so genannten Anti-Folk-Szene in New York zu verdanken. Als 17-jähriger kam der aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammende Green in die Stadt, spielte in U-Bahn-Stationen und Szene-Clubs mit den "Open Mikes", den für herumstromernden Musikern offenen Mikrofonen. Eines Montagabends spielte er im "Cyber Cafe" ein paar Songs, traf fünf Leute, sprach und sang mit ihnen bis 3.00 Uhr morgens und dachte: "Mann, ich will wiederkommen. Ich will zu dieser Szene gehören und hier leben." Ein Jahr ging das so, bis eines Tages ein Talentsucher der Plattenfirma Rough Trade vorbeischaute. "Eine Kontaktperson in New York hatte sie auf mich aufmerksam gemacht. Sie hatten gerade großen Erfolg mit den Strokes, und sie dachten: 'Vielleicht geht da wieder ein New-York-Ding ab.' Und sie nahmen mich mit den Moldy Peaches unter Vertrag. Wir waren mit den Strokes auf ihrer ersten Tournee unterwegs, in Großbritannien und den USA als Opening Act."
Die Musiker der Anti-Folk-Szene hatten laut Green eins gemeinsam: Ihre Lieder wurden durch die Texte einzigartig, den musikalischen Fluss der Worte. "Es ist eine Schande, dass sie nicht größer herauskamen. Wenn sie Verträge bekommen hätten, hätten sie großartige Platten gemacht. Sie haben das auch auf eigene Faust gemacht, aber das bekommen dann nicht so viele mit. Viele haben sich verbittert zurückgezogen. Ehrlich, sie waren die talentiertesten Leute, und niemand hat sie beachtet".
Alle Altersgruppen im Publikum
Die Anti-Folk-Szene entstand 1982, als die "etablierte" Folkmusik laut Green in einer nostalgischen Vergangenheitsverklärung gefangen war und sich von neuen Einflüssen wie New Wave und Punk abschottete. Sie ist ein Treffpunkt von Straßenmusikern, die in Kneipen für Trinkgelder spielen oder auf Plätzen den Hut kreisen lassen. Sie verändert sich ständig; nach den beiden Touren mit den Strokes habe er gerade mal noch einen Bekannten getroffen. "So ist das halt. Die Zeiten ändern sich, und die Leute ziehen weiter. Es ist ein guter Ort, um als Songwriter zu wachsen und dann weiter zu ziehen."
Green ist musikalisch weitergezogen und könnte einer der ganz Großen werden. Zudem hat er seine nicht vertonbaren Gedichte und "Magazines" zu einem Buch zusammengefasst, die im Suhrkamp Verlag erscheinen. Anders als seine Vorbilder The Doors bei ihrem Karrierestart - bei "Over The Sunrise" klingt er mit Lust und Wonne wie Jim Morrison - ist er nicht auf eine neue Jugendkultur fixiert. Bei seinen Konzerten sieht er alle Altersgruppen: "Einige Leute sind älter als meine Eltern, viel älter, einige würde ich unglaublich alt nennen. Und ich denke, das ist nett, Mann." In Barcelona habe eine 60-jährige Frau ihm sogar einen Kuchen gebracht. "Es ist gut, dass Jung und Alt zusammen kommen, und ich empfinde es als Privileg, das auslösen zu können."
Tourdaten:
10.02. Hannover (Faust)
11.02. Berlin (Postbahnhof)
15.02. Hamburg (Deutsches Schauspielhaus)
17.02. Dresden (Alter Schlachthof)
18.02. Erlangen (E-Werk)
19.02. Wien (Wuk)
21.02. Graz (Orpheum)
22.02. München (Muffathalle)
24.02. Karlsruhe (Tollhaus)
25.02. Darmstadt (Centralstration)
26.02. Köln (Live Music Hall)
27.02. Bochum (Bhf. Langendreer)