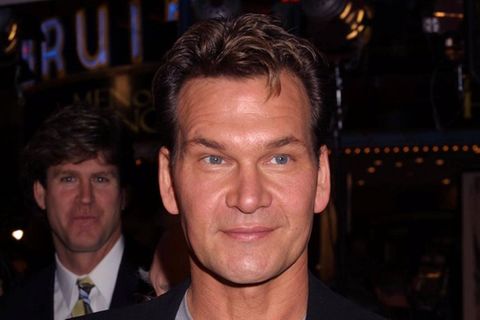Ob in Doku Soaps, im Internet oder in Psycho- Sendungen im Radio - viele breiten heute in einem Ausmaß Privates über sich in der Öffentlichkeit aus, das vor einigen Jahren noch undenkbar war. Jo Reichertz (54), Professor für Kommunikationswissenschaft in Essen, hat die Motive von Menschen untersucht, die sich beispielsweise im Fernsehen präsentieren.
Warum lassen sich normale Menschen auf dem Hunde-Platz, im Krankenhaus, sogar im eigenen Schlafzimmer von TV-Kameras begleiten?
Reichertz: "Dieses Verhalten erscheint für viele Menschen unverständlich, aber die Kandidaten solcher Shows wollen damit Probleme lösen. Sie wollen beispielsweise öffentlich um Verzeihung für etwas bitten oder jemandem die Größe der eigenen Liebe demonstrieren."
"Warum bezeugen diese Leute sich ihre Liebe nicht einfach wie früher auf einer Parkbank?"
Reichertz: "Privatpersonen reagieren mit ihrem Gang in die Öffentlichkeit auf die Unübersichtlichkeit der Gesellschaft. Woher erkennt der Einzelne, was er wert ist? Wir leben in einer Kultur der Unübersichtlichkeit; in der es für viele wichtig ist, von vielen aufmerksam angesehen zu werden. Wenn einen nicht nur zehn Leute ansehen, sondern hunderte oder hunderttausende, scheint der Wert des Angesehenen automatisch zu steigen."
Wie weit fallen die Schamgrenzen denn noch?
Reichertz: "Die Grenzen fallen im Grunde ja gar nicht. Das Verhältnis von Individuen und Gesellschaft, von Privatheit und Öffentlichtlichkeit wird vielmehr zur Zeit neu austariert. Die Kultur des Bürgertums mit ihren Schamgrenzen war ja auch nicht 'natürlich' oder der Endpunkt der Entwicklung, sondern die damals herrschende Ansicht und somit gesellschaftlich bestimmt. Heute beziehen sich die Schamvorstellungen eben nicht mehr so sehr auf Körperöffnungen und Sexualität, sondern zum Beispiel auf Armut und Krankheit. Hierüber spricht man öffentlich heute so gut wie nicht mehr."