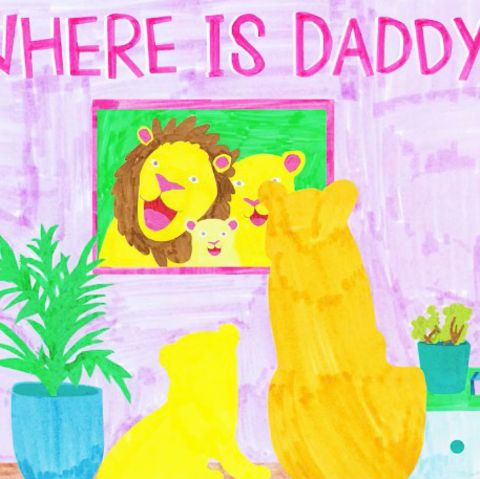Wieder einmal besagt eine Studie des Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass Frauen, die die Uni besucht haben, später und weniger Kinder bekommen als andere Frauen. In den Reaktionen auf dieses Ergebnis schwingt sofort immer ein gewisser Vorwurf mit: "Warum geizt ihr Akademikerfrauen so mit euren Genen?", hört man da raus. Wenn es besonders menschenverachtend sein soll, auch mal: "Es bekommen immer nur die falschen viele Kinder." Gemeint sind dann sozial schwache Familien.
Studierenden und studierten Frauen wird bei dieser Gelegenheit gern vorgeworfen, die Karriere sei ihnen wohl wichtiger als die Familiengründung. Vermutlich stellen die Menschen sich dann erfolgreiche Anwältinnen in Nadelstreifen-Kostümchen und mit strengen Brillen auf der Nase vor. Oder Bankerinnen. Oder Politikerinnen. Weil, davon gibt es in Deutschland ja so viele ... (Ironie off.)
Wollen wir lieber Karriere statt Kinder?
Das sind lächerliche Klischees, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Und auch der Gedanke dahinter ist einfach falsch. Erstens hat natürlich jede Frau das Recht, sich gegen Kinder zu entscheiden. Das gilt für Frauen aus allen sozialen Schichten. Und das ist nichts Verwerfliches, denn wer nicht wirklich Lust auf die Mutterrolle hat, wäre sicher auch nicht besonders gut darin. Selbst Frauen, die sich immer Kinder gewünscht haben, struggeln ja oft mit dieser mächtigen Aufgabe, wenn es soweit ist. Zweitens aber hat die niedrige Geburtenrate bei Akademikerinnen eben einfach auch mit Umständen zu tun, die das Kinderkriegen – oft unnötig – schwer machen.
Im Studium ist man in einer sozial riskanten Situation wie vorher und nachher wohl selten wieder: Bei vollgepackten Stundenplänen hat man kaum noch Zeit, nebenher zu arbeiten. Bleibt bescheidenes Bafög, dazu kommen in den großen Studentenstädten horrende Mieten – und immer ist da die Gefahr, es nicht zu packen. Ein abgebrochenes Studium ist für den Lebenslauf fast schlimmer als gar keines. In dieser Situation ein Kind bekommen? Ein Wesen, das von einem Stabilität erwartet, während man selbst gerade händeringend versucht, sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken? Kann man, mit einer guten Portion Mut, machen. Ich hätte das definitiv nicht gekonnt.
Der richtige Zeitpunkt? Irgendwie nie.
Gut, weiter. Wir sind jetzt etwa Mitte, Ende 20. In vielen Berufen reicht ein Studienabschluss noch nicht einmal aus, um richtig einzusteigen. Wir lassen uns auf weitere zwei Jahre als Trainee oder in Volontariaten, Referendariaten und obligatorischen Praktika ein. Wir verdienen endlich sowas ähnliches wie richtiges Geld, aber arbeiten doppelt so viel wie unsere bereits fest angestellten Kollegen, für das halbe Gehalt. Wir wollen zeigen, was wir können – und wir wollen, wenn möglich, nach diesen zwei Jahren übernommen werden.
Ob das nun klappt oder nicht, danach folgt bestenfalls eine Festanstellung. Aber natürlich befristet. Sagen wir, auf ein Jahr. Die meisten von uns sind jetzt 30 und, ja, denken inzwischen auch mal über die Familienplanung nach. Spätestens, weil die Gynäkologin beim Routine-Check-up plötzlich unvermittelt danach fragt. Aber von Zeitvertrag zu Zeitvertrag vertagen wir die Entscheidung. Denn ein Kind bekommen, das deckelt nicht etwa nur unsere Karriereplanung. Es gefährdet unsere komplette Berufstätigkeit.
Es geht hier nicht um übertriebenen Ehrgeiz, Machtpositionen oder berufliche Selbstbestätigung. Es geht um reine Selbsterhaltung – denn wir müssen arbeiten, um zu leben. Genau wie jeder andere auch. Und ein Baby heißt: Mindestens ein Jahr komplett raus zu sein. Vermutlich länger. Und das könnte heißen: Vielleicht für immer – oder zumindest: für lange. Denn welcher Arbeitgeber verlängert denn einen befristeten Vertrag, wenn er stattdessen auch jemand jungen, flexiblen einstellen kann? Statt jemanden "durchzufüttern", der zuerst lange ausfällt und danach durch ein Kind zeitlich eingeschränkt ist und eventuell bei diversen Kinderkrankheiten auch mal ein paar Tage ausfällt?
Wer nach der Schule zielstrebig eine Ausbildung anfängt, verdient danach zwar eventuell im Berufsleben weniger (obwohl das nicht zwingend so sein muss), spart in Sachen Familienplanung aber ein paar entscheidende Jahre. Viele meiner Freundinnen, die nicht studiert haben, haben inzwischen tatsächlich Kinder. Mehrere sogar. Sie sind einfach früher an diesem verhältnismäßig "sicheren" Punkt ihrer Karriere angekommen, an dem sie unbefristet angestellt sind und zudem schon so lange in einem Betrieb arbeiten, dass es dort niemand mehr selbstsüchtig und unhöflich findet, für ein Baby mehrere Jahre auszufallen. Denn das sind Urteile, mit denen man als potenzielle Mutter leben muss.
Verantwortung für ein Kind – respekteinflößend
Und ganz ehrlich, selbst wenn beruflich alle Rahmenbedingungen stimmen sollten, flößt es mir auch mit Anfang 30 noch immer einen höllischen Respekt ein, den Alltag mit Kind zu organisieren. Was mir Freunde über die schwierige Kita-Suche erzählen, ist entmutigend. Das Angebot an familientauglichen Wohnungen in Großstädten – extrem schwierig. Wie niedrig das Elterngeld ist, hat mich schockiert. Und dann ist da in meinem Hinterkopf immer noch meine eigene Kindheit: Eine Mutter, die zu Hause war und sich rund um die Uhr um mich kümmern konnte. Großeltern, die nur wenige Straßen weiter wohnten, und mit Begeisterung das Babysitting übernommen haben.
Diesen Luxus hätten meine Kinder nicht. Sie wären eine "Sache" von vielen in meinem Leben, die ich jonglieren müsste. Das klingt jetzt ganz fürchterlich und irgendwie falsch, aber schon jetzt fällt in meinem kinderlosen Alltag neben Arbeit, Schlaf und rudimentärer Haushaltsführung ein Großteil meines Soziallebens hintenüber. Ich traue mir nicht mal die Haltung eines Haustiers zu, weil ich zu wenig Zeit dafür hätte. Wäre es überhaupt verantwortungsvoll, ein Kind zu haben? Könnte ich auch nur ansatzweise so gut für es da sein wie meine Mutter für mich? Ich würde wollen, dass mein Kind der Mittelpunkt meines Lebens ist, aber ich weiß nicht, ob ich mein Leben so um mein Kind herumbauen könnte, dass sich niemand vernachlässigt fühlt.
Wir könnten Hilfe gebrauchen
Viele dieser Probleme betreffen nicht nur Akademikerinnen, sondern schlicht alle Frauen. Bei Akademikerinnen kommt nur der Zeitfaktor hinzu, der die Situation noch einmal schwieriger macht. Ganz lösen kann man diesen Konflikt nicht. Aber wenn die Politik wirklich möchte, dass wir mehr Kinder bekommen, dann sollte sie mehr dafür tun, uns das einfacher zu machen.
Nehmt uns die Existenzangst, nehmt uns die unnötigen Hindernisse. Tut was gegen den Kita-Mangel, senkt oder streicht die Gebühren für die Betreuung, sorgt für bezahlbaren Wohnraum und verhindert unnötige Befristungen von Arbeitsverträgen. Das wären ganz konkrete Maßnahmen, die ein bisschen helfen würden, eine so wichtige Entscheidung zu treffen. Denn viele Akademikerinnen wünschen sich Kinder, ganz sicher, aber sie trauen sich nicht.