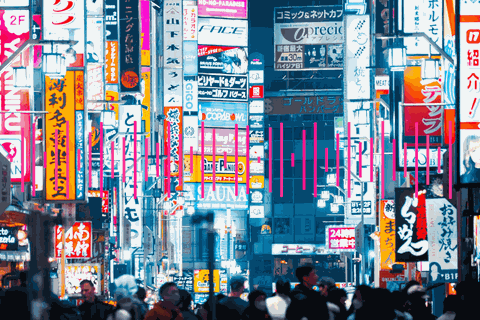Ihre Erkenntnisse lieferten dem Nobelkomitee zufolge die Basis für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden etwa gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten: Die Immunforscher Shimon Sakaguchi (Japan), Mary Brunkow und Fred Ramsdell (beide USA) erhalten in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist mit 11 Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Euro) dotiert.
Ausgezeichnet werden die Forschenden für Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz. Sie verhindert, dass das Immunsystem eigene Körperzellen angreift und sich eine Autoimmunerkrankung oder Allergien entwickeln. "Wir verstehen jetzt besser, wie das Immunsystem funktioniert und warum nicht jeder von uns eine schwere Autoimmunerkrankung entwickelt", erklärte Olle Kämpe, Vorsitzender des Nobelkomitees.
Sakaguchi "überrascht" - Kollegen nicht zu erreichen
An der Universität Osaka trat nach der Bekanntgabe ein gefasst wirkender Sakaguchi vor die Presse. Er habe sich zwar vorstellen können, dass es eine Auszeichnung geben könne, sagte der Japaner. "Aber dennoch bin ich überrascht und geehrt, nun eine solche Ehre zu erhalten."
Der Sekretär der Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts, Thomas Perlmann, hatte zuvor schon von seinem Anruf bei Sakaguchi berichtet: "Er war von der Nachricht ganz gerührt." Brunkow und Ramsdell leben und arbeiten an der US-Westküste – zum Zeitpunkt der Preisbekanntgabe war es dort noch vor 3.00 Uhr morgens und sie verpassten die ersten Anrufe.
Bei Fehlfunktionen des Systems drohen Krankheiten
Sakaguchi hatte Mitte der 1990er Jahre entscheidende Grundlagen geschaffen: Er identifizierte eine bislang unbekannte Gruppe von Immunzellen, die sogenannten regulatorischen T-Zellen, die die Reaktion des Immunsystems mitsteuern. Dank dieser Zellen bleibt das Immunsystem im Gleichgewicht. Es unterscheidet mit ihrer Hilfe, was der Körper toleriert und was nicht.
Einige Jahre später entdeckten Brunkow und Ramsdell, dass eine bestimmte Mutation des Gens Foxp3 Mäuse anfällig für Autoimmunerkrankungen macht. Sakaguchi zeigte kurz danach, dass dieses Gen für die regulatorischen T-Zellen essenziell ist. Nützliche Bakterien im Darm würden ohne die Zellen nicht toleriert, ein heranwachsendes Kind im Mutterleib abgestoßen. Bei Fehlfunktionen des Systems drohen Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Rheuma.
Therapieansätze zielen auf regulatorische T-Zellen
Regulatorische T-Zellen gelten daher als Zielmoleküle für Therapien, sowohl bei Erkrankungen, bei denen das Immunsystem über die Stränge schlägt, als auch bei Erkrankungen, bei denen das Immunsystem nicht mit der gebotenen Konsequenz gegen Missstände vorgeht. Für die einen müssen die Zellen gestärkt werden - gegen Krebs hingegen versucht man, ihre Aktivität zu dämpfen.
Generell soll das Immunsystem dafür sorgen, den Körper vor Krankheitserregern und schädlichen Stoffen zu schützen. Dafür werden bestimmte Immunzellen zentral im Thymus geschult, erläuterte Carsten Watzl von der Technischen Universität Dortmund. "Das reicht aber noch nicht aus." So gebe es noch einen weiteren Mechanismus, der Autoimmunreaktionen verhindern soll.
"Große Leistung von Sakaguchi"
"Wie das funktionierte, war lange Zeit unklar", so Watzl. Nachdem sich Annahmen über sogenannte Suppressor-Zellen nicht bestätigt hatten, war diese Forschung verpönt. "Es ist die große Leistung von Sakaguchi, dass er drangeblieben ist und die regulatorischen T-Zellen entdeckt hat, trotz großer Skepsis in der Fachwelt."
Helfen könnten die Erkenntnisse künftig einmal bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Krebstherapien und in der Transplantationsmedizin. Nach Angaben von Perlmann laufen derzeit mehr als 200 klinische Studien oder seien geplant. Wie lange es noch bis zur Anwendung im klinischen Alltag dauern werde, lasse sich nur schwer vorhersagen. Watzl betonte: "Von einem Produkt sind wir noch weit entfernt."
"Blauhelme des Immunsystems"
Brunkow wurde 1961 geboren. Sie arbeitet am Institute for Systems Biology in der US-Westküstenmetropole Seattle. Der 64-jährige Ramsdell ist wissenschaftlicher Berater bei Sonoma Biotherapeutics in San Francisco. Der 74 Jahre alte Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität Osaka - japanischen Medien zufolge ebenso wie seine Frau Noriko, mit der er seit über 40 Jahren verheiratet ist.
Für die Entdeckung der "Blauhelme des Immunsystems" wurde Sakaguchi auch schon mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2020 geehrt - nicht nur für seine bahnbrechende Entdeckung, "sondern auch für seine Weitsicht und konsequente Beharrlichkeit". Sakaguchi habe seinen eigenen Experimenten mehr getraut als der bis dahin gängigen Lehrmeinung, hieß es vom Stiftungsrat.
Sakaguchi: Einfach eins nach dem anderen tun
Auf die Frage nach seinem Lebensmotto sagte Sakaguchi kurz nach der Nobelpreisbekanntgabe: "Wenn ich mir aussuchen müsste, dann wäre es wohl: "eins nach dem anderen". Das gilt sowohl für die Experimente in der Forschung als auch für die Artikel, die ich schreiben muss – man bringt eben eines nach dem anderen zu Ende."
Es folgen Physik und Chemie
Mit dem Medizin-Preis startete der Nobelpreis-Reigen. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Preises benannt. Es folgen die für Literatur und für Frieden. Die Reihe der Bekanntgaben endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Zentralbank gestifteten sogenannten Wirtschaftsnobelpreis. Die feierliche Übergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).