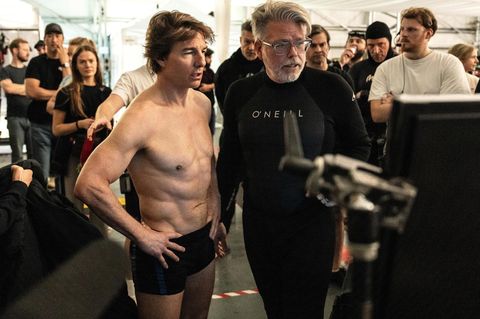"Historisch", bei aller Liebe, war das nicht. Wer von der so genannten "virtuellen Debatte" zwischen Usern und den acht demokratischen Präsidentschaftskandidaten einen epochalen Aufbruch in Richtung Politik 2.0 erwartet hatte, verlebte einen enttäuschenden Abend.
Es gab ein paar menschliche Fragen, ein paar interessante Seitenaspekte und auch die Kandidaten mühten sich redlich, in ihren eigenen User-created-content-Imagefilmchen den Stil der Netzgemeinde zu treffen. Doch bis auf ganz wenige kreative Momente erinnerte die Veranstaltung an eine etwas größer geratene Bürgersprechstunde des SPD-Ortsverbands Wuppertal-Barmen: Wähler fragen, Politiker stanzen. Vielleicht war ja auch das mit "historisch" gemeint.
So blieb die wichtigste Erkenntnis dabei fast das Geständnis eines CNN-Redakteurs, der zugab, dass bei den Fragen der User "einige dabei gewesen sind, die wir Journalisten bestimmt nicht so gestellt hätten". Und dabei dacht man immer, dass fehlende Volksnähe ein auf Politiker beschränktes Phänomen sei…
Neue Facetten, aber keine Revolution
Kein Zweifel: Youtube und seine mittlerweile hunderte Klone haben eine neue, vielleicht auch wichtige Facette ins politisch-öffentliche Leben eingebracht. Manche halten die Videoportale und ihre Möglichkeiten zur unbegrenzten Kommunikation bereits für eine Revolution im Aufmerksamkeitsringkampf zwischen Oben und Unten, mit Vorteilen für Unten. Angesichts der vollmundig angepriesenen WWW-Debatte der letzten Nacht muss man allerdings resümieren: Revolutionen sehen anders aus.
Denn TV-Experimente, die Wahlvolk und Kandidaten live zusammen brachten, hat es sogar im analogen Deutschland schon gegeben. Unvergessen die Bürgersprechstunden, die Sat.1 bereits im Jahr 1994 in Deutschland mit Helmut Kohl abhielt. Da saßen dann vorselektierte Wähler, die dem bereits da zum Monolithen erstarrten Kanzler vorselektierte Fragen stellen durften, das ganze moderiert von Journalisten, die eilfertig bemüht waren, den seifig-harmonischen Rahmen der Veranstaltung nicht zu sprengen.
Medien-Demokratie heißt nicht mehr Demokratie
Und auch in den USA konnten Bürger ihre Kandidaten bereits vor über zehn Jahren live im TV befragen: in den so genannten Presidential Debates 1996. Auch da waren Fragesteller und Fragen zuvor - genauso wie jetzt bei Youtube und CNN - "nach Relevanz und allgemeiner Bedeutung" ausgesiebt worden. Insofern präsentierter die TV/Web-Kooperation alten Wein im neuen Tube.
Machen wir uns nichts vor: Wo normale Menschen auf Politiker treffen, ganz gleich auf welchem Hyper-Channel, wird es auch in Zukunft nicht anders zugehen, wie sonst üblich. Politik wird im Endeffekt auch im Youtube-Zeitalter immer eine geschlossene Party von privilegierten Kleinstzirkeln in schall-gedämpften Hinterzimmern bleiben. Die fortschreitende Medien-Demokratie (wahlweise auch Medien-Diktatur) führt nicht zwangsläufig zu mehr Demokratie.
Noch gehört das Web den Wahlkampfstrategen
Die wirklichen Veränderungen, die mit der Digitalisierung und dem damit verbundenen Zugang des Volkes zu Medien-Produktionsmitteln und -Verbreitungskanälen bedeuten, stehen erst am Anfang: Wenn mit Hilfe von Blogs, Foren, Videos in Zukunft noch mehr Missstände schneller aufgedeckt, gebrochene Versprechen angeprangert und peinliche Patzer der Volksvertreter dokumentiert werden können, dann wird das Web seinen Teil dazu beitragen, dass Politik zumindest öfter die Hinterzimmer verlassen muss, um Dinge zu erklären. In den USA hat das schon ein paar Mal funktioniert - aber noch gehört das WWW dort und vor allem hierzulande noch den professionellen Wahlkampfstrategen, die ihre Botschaften mal offen, mal subtil ins WWW streuen.
Muss aber ja nicht so bleiben.