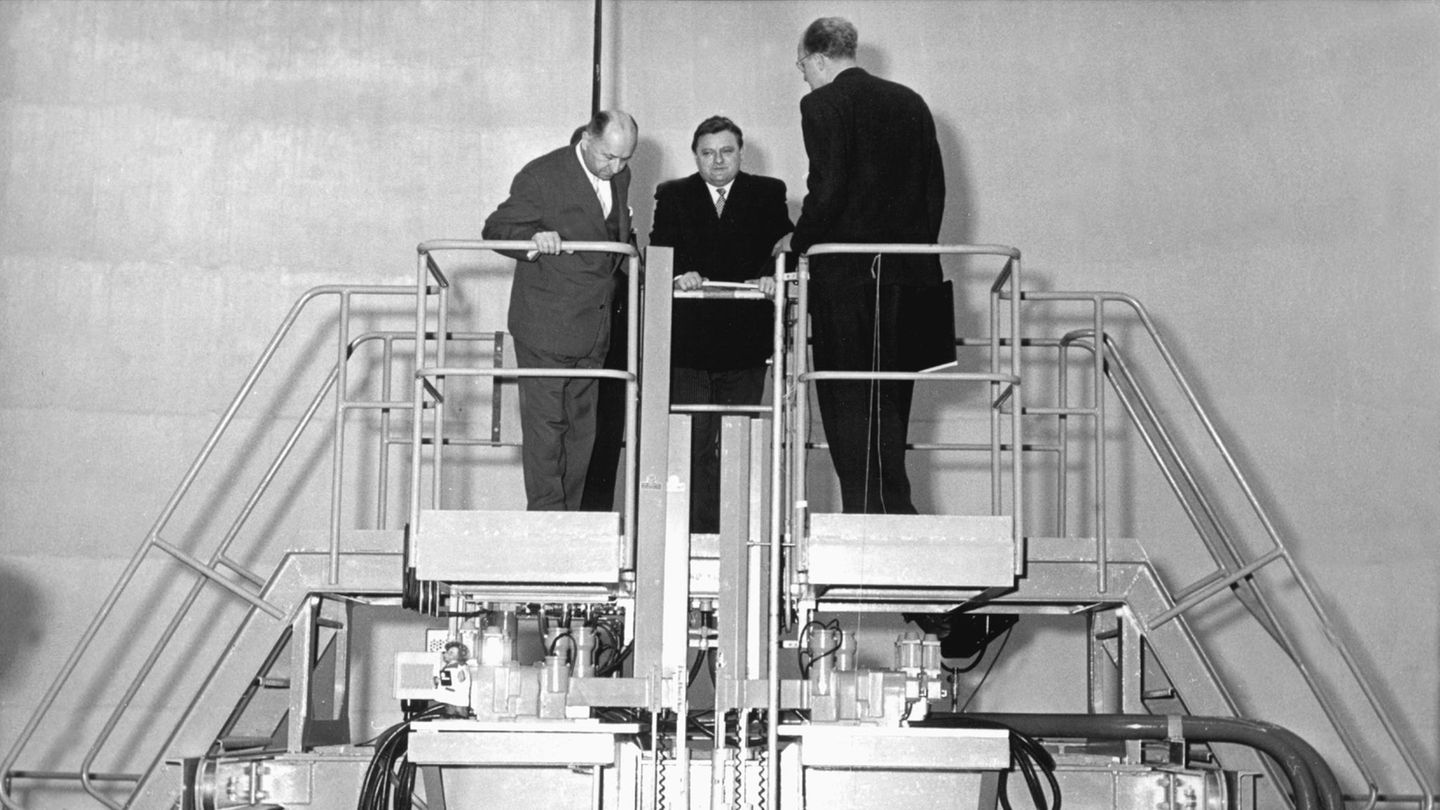Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Irgendwo zwischen lebendiger Großstadt, Blues-Musik und malerischer Natur steht er: der Supercomputer von xAI, Elon Musks neuem KI-Startup. Hier verwirklicht der Tech-Milliardär gerade seinen Traum vom bald größten Rechenzentrum der Welt. Innerhalb von nur 121 Tagen wurde es am Ufer des Mississippi River in diesem Jahr errichtet. Doch xAI ist nur eines von Hunderten neuen Rechenzentren in den USA.
Der KI-Boom der letzten Jahre hat den Bedarf an Rechenleistung und Energie sprunghaft in die Höhe getrieben. Um die wachsende Nachfrage zu decken, benötigen Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Amazon vor allem eines: Energie.
Befragungen zeigen, dass KI eine immer größere Rolle in unserem Alltag spielen wird. Laut einer Befragung des Allensbach-Instituts im Auftrag der Deutschen Telekom greift jeder vierte Deutsche auf KI-Chatbots zurück. Die Antwort des Chatbots Chat-GPT verbraucht etwa zehnmal so viel Energie wie eine übliche Google-Suche. Damit steigt der Energiebedarf, nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA.
Strom aus Mini-Atomkraftwerken soll Künstliche Intelligenz versorgen
Um dieser enormen Nachfrage gerecht zu werden, haben Microsoft, Google und Amazon Verträge mit Betreibern von Kernkraftwerken abgeschlossen. Google will ab 2030 sogar ein eigenes Mini-Atomkraftwerk in Betrieb nehmen. Bis 2035 sind weitere Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 500 Megawatt geplant. Das würde ausreichen, um eine Stadt wie Zürich oder Leipzig komplett mit Strom zu versorgen. Eine halbe Million Menschen könnten im Winter die Heizung aufdrehen und im Sommer die Klimaanlage nutzen.
Google, Microsoft und Amazon legen damit eine überraschende Kehrtwende hin: Vor dem KI-Boom hatten sich die Tech-Konzerne zu CO2-neutralen, erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie bekannt und stark in diese Technologien investiert. Allerdings sind diese Energiequellen wetterabhängig und daher nicht immer zuverlässig. Für den steigenden Energiebedarf der KI reichen Sonne und Wind nicht aus – der unstillbare Energiehunger der KI lässt sich mit einer rein grünen Versorgung nicht stillen, zumindest behaupten das die Tech-Konzerne. Denn Atomenergie ist langfristig günstiger und damit wirtschaftlicher als grüne Energie.
Die Schlacht von Brokdorf und ein Karussell im Kühlturm – die Ära der Atomkraft in Deutschland
Google-Manager Michael Terrell beispielsweise plant deshalb bis zu sieben eigene Kraftwerke, sagte er im Interview mit der "Financial Times". Offen sei noch, ob der Strom ins Netz eingespeist oder nur an die Rechenzentren geliefert werde. Auch die finanziellen Details des Deals mit dem Energiekonzern Kairos Power sind noch unklar – ob Google den Bau der Kraftwerke mitfinanzieren oder erst nach Fertigstellung für den bezogenen Strom bezahlt.
Die Bauweise der Mini-Reaktoren, die weniger Brennstoff verwenden und damit weniger Abfall erzeugen, soll die Betriebskosten gering halten und Sicherheitsvorteile bieten. Allerdings warnen Kritiker vor möglichen Risiken. Sie fürchten, dass Sicherheitsstandards zugunsten der Wirtschaftlichkeit gesenkt werden – etwa durch den Verzicht auf dicke Betonhüllen, die große Reaktoren schützen. Darüber hinaus arbeiten die neuen Reaktoren mit noch unerprobten Verfahren, und das Verhalten von Materialien und der chemischen Prozesse im Inneren sind oft schwer einzuschätzen.
Die Rückkehr von Three Mile Island – mehr Trauma als Hoffnung?
Microsoft hat derweil eine andere Idee. Statt neuer AKW möchte der Internetgigant das stillgelegte Kraftwerk Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania wieder in Betrieb nehmen. Im März 1979 ereignete sich dort der schwerste Unfall in der Geschichte US-amerikanischer Atomkraftwerke. Technische Probleme und menschliche Fehler lösten eine teilweise Kernschmelze aus. Dabei können radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangen, mit fatalen Folgen für Mensch und Umwelt, wie die Beispiele Tschernobyl und Fukushima zeigen.
Der Vorfall hat sich tief ins Gedächtnis der Anwohner gegraben. Die US-Regierung behauptete, die Strahlung sei in akzeptablen Grenzen geblieben. Kein Bewohner sei unmittelbar zu Schaden gekommen. Auch Todesfälle oder langfristige Gesundheitsrisiken wurden bislang offiziell nicht bestätigt. Doch Anwohner berichten bis heute von Symptomen wie Übelkeit, Haarausfall und Hautausschlägen kurz nach dem Unfall. Auch Krebserkrankungen würden seit dem Unfall häufiger in der Region diagnostiziert. Eine 2017 veröffentlichte Studie deutet eine Verbindung zwischen der Strahlung und Fällen von Schilddrüsenkrebs an.
Patty Longnecker lebte zur Zeit des Unglücks wenige Kilometer entfernt mit ihren Angehörigen. "Jede Familie hier hat eine Krebs-Geschichte", sagt sie im Interview mit WHYY, einem öffentlichen Sender aus Pennsylvania. Ihre eigene Familie wurde damals evakuiert, doch in den Folgejahren hätten sich Krebs- und Leukämiediagnosen in ihrer Nachbarschaft gehäuft. "Selbst heute, 40 Jahre später, fragt sich jeder hier bei einer Krebsdiagnose: War das wegen Three Mile Island?"
Dass Microsoft das Werk wieder hochfahren möchte, stößt auf zwiespältige Reaktionen. Das Trauma von damals sitzt tief. Andererseits benötigt die Region dringend neue Arbeitsplätze. Und beide Präsidentschaftskandidaten gehen mit ihren wirtschaftlichen Versprechen auf dieses Bedürfnis ein – insbesondere in dem Swing State Pennsylvania, wo der Industriesektor das Rückgrat vieler Existenzen ist.
Laut einer Studie des Pennsylvania Building & Construction Trades Council könnte die Wiederinbetriebnahme von Three Mile Island rund 3400 neue Arbeitsplätze schaffen, über 3 Milliarden US-Dollar an Steuererträgen einbringen und das Bruttoinlandsprodukt von Pennsylvania um knapp 1,76 Prozent steigern.
Atomkraft als neue Risikodimension in geopolitischen Spannungen
In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen gewinnen Atomkraftwerke eine neue sicherheitspolitische Dimension: Reaktoren wurden schon in der Vergangenheit Ziel militärischer Angriffe und Sabotage. So kam es seit 2022 wiederholt zu Angriffen russischer Streitkräfte auf das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja. Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), warnte erst vor wenigen Monaten: "Erneut sehen wir eine Eskalation der Gefahren für die nukleare Sicherheit." Gleichzeitig wächst die Bedrohung durch Cyberangriffe auf Atomreaktoren. Russische Hackergruppen versuchen zunehmend kritische Infrastrukturen in der Ukraine zu attackieren und Zugang zu strategisch wichtigen Steuerungssystemen zu erlangen.
In diesem Kontext ist auch die Rolle von Tech-Milliardären wie Elon Musk besorgniserregend. Ihr unberechenbares Verhalten hat in der Vergangenheit oft Fragen zur Stabilität und Verlässlichkeit aufgeworfen. Sie üben erheblichen Einfluss auf Infrastrukturprojekte aus, ohne einer strengen Kontrolle durch die internationale Gemeinschaft zu unterliegen. Im Ernstfall könnten ihre wirtschaftlichen Interessen nationale und internationale Sicherheitsbedenken in den Hintergrund drängen.
Atomkraft, ja bitte oder nein danke?
Ein hungriger Magen will gestillt werden. Auch der eines Rechenzentrums irgendwo in Memphis, Tennessee, oder im kalifornischen Silicon Valley. Während die Tech-Welt auf die nächste große Innovation hinarbeitet, hängt ihr Erfolg auch von den Plänen der neuen US-Regierung ab. Beide Präsidentschaftskandidaten sind der Atomenergie nicht abgeneigt, doch während Kamala Harris langfristig deutlich stärker in CO2-neutrale Energien aus Wind und Sonne investieren und die Abhängigkeit von Atomkraft reduzieren möchte, setzt Donald Trump verstärkt auf die Nutzung billiger Energie der AKW. In einem Interview warnt er jedoch auch vor den Gefahren, insbesondere durch militärische Angriffe.
Die Nutzung günstiger Energie aus Atomkraft muss nicht die einzige Option für Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft sein. Die Tech-Giganten hätten die finanziellen Kapazitäten auch in die Erforschung und den Ausbau von Speicherlösungen für Wind- und Solarenergie investieren können. Alles andere ließe sich als bequeme Entscheidung, die wirtschaftliche Interessen über das Gemeinwohl stellt, deuten.