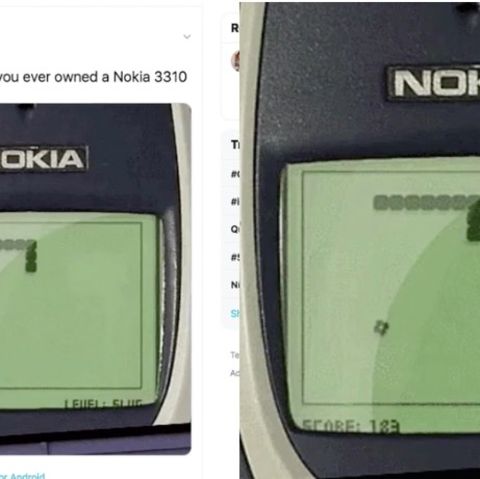Kürzlich habe ich etwas geschafft, was auf meiner ewigen To-do-Liste steht, seit ich einen Führerschein habe: Ich bin mit dem allerletzten Tropfen Benzin in eine Tankstelle gerollt, auf dem Armaturenbrett die Anzeige "Sie haben noch 0 Kilometer, bis Sie tanken müssen". Irrelevant, ob ich trotz dieser Anzeige vielleicht sogar noch zweieinhalb Kilometer weiter hätte fahren können.
Meike Winnemuth: Um es kurz zu machen
Meike Winnemuth schreibt Kolumnen, seit sie Buchstaben kennt, seit 2013 auch für den stern. Lange hatte sie einen kolossalen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Autoren, die 900-Seiten-Wälzer hinkriegen. Inzwischen hat sie sich damit abgefunden, dass sie eine Textsprinterin mit Kurzstreckenhirn ist und bekennt sich zum norddeutschen Motto "Nicht lang schnacken". Wenn sie sich dann allerdings doch mal zu einem richtigen Buch quält, wird das verrückterweise gleich ein Bestseller wie ihr Reisebuch "Das große Los. Wie ich bei Günter Jauch eine halbe Million gewann und einfach losfuhr".
Entscheidend waren allein die letzten fünf Minuten vor der Tankstelle, eine Mischung aus milder Selbstbeschimpfung ("Hättste mal rechtzeitig ..."), dem köstlichen Kribbeln, ob’s noch reicht, und dem großen Ha!, als es dann tatsächlich klappte. Für dieses Gefühl hätte ich gern eine Vokabel. Ein Wort, das dieses spezielle Glück triumphaler Erleichterung beschreibt.
Ein Lexikon vom Glück
Auf der Suche nach so einem Wort durchforste ich gerade das faszinierende Projekt des britischen Psychologen Tim Lomas, der seit 2015 ein Lexikon unübersetzbarer Glücksvokabeln aus allen Sprachen der Welt zusammenträgt, das "Positive Lexicography Project". Jede Kultur kennt Wörter für positive Gefühle, die es so nur in ihrer Sprache gibt. Lomas kam auf die Idee zu der Sammlung, als er den Vortrag einer Doktorandin aus Helsinki hörte. Sie sprach über "sisu", einen unübersetzbaren Ausdruck aus dem Finnischen, der eine besondere Form der Willensstärke beschreibt: die tiefe Entschlossenheit, auch dann nicht aufzugeben, wenn eine Situation aussichtslos erscheint.
Lomas begann daraufhin, ein internationales Glücksglossar anzulegen, das seitdem mit der Hilfe vieler Zuträger ständig wächst. Es finden sich darin Ausdrücke wie "wai-wai" (japanisch): das Geräusch spielender Kinder. Oder "cafuné" (portugiesisch): die Geste, jemandem zärtlich durch die Haare zu streicheln. Oder "jayus" (indonesisch): ein Witz, der so unlustig ist, dass man allein schon deshalb lachen muss. Oder "sprezzatura" (italienisch): die Kunst, den Anschein der Leichtigkeit und Mühelosigkeit auch bei der Bewältigung schwieriger Probleme zu bewahren. Oder "meraki" (griechisch): die Hingabe, mit der man etwas tut und dabei etwas von sich selbst in das Ergebnis hineinlegt.
Auch aus dem Deutschen sind viele Begriffe in das Lexikon aufgenommen worden, für die es keine genauen Entsprechungen in anderen Sprachen gibt: beschaulich, Feierabend, Freudentaumel, Geborgenheit, Heimat, Herzklopfen, Konfliktfähigkeit, Schnapsidee, Sehnsucht, Sternstunde, sturmfrei, Zweisamkeit. (Es wäre interessant, daraus die Quersumme zu ziehen und zu einer Essenz des Deutschen zu gelangen.)
Worum es Lomas geht: mithilfe der Sprache die Wahrnehmung für das Glück zu schärfen – das der anderen, aber auch das eigene. Sprache schafft Realität. Was man benennen kann, wird Wirklichkeit, zumindest da, wo es drauf ankommt: in den Köpfen. "Mit diesen Wörtern können wir Gefühle mitteilen, von denen uns nicht mal bewusst war, dass wir sie empfinden", sagt Lomas. Es stecken mehr Freuden in uns, als uns klar ist, und manchmal helfen erst andere Sprachen, sie zu benennen, wie etwa die Exportschlager Nirwana, Karma und hygge zeigen.
Die unbezwingbaren Verlangen
Vielleicht muss man aber gar nicht in anderen Sprachen stöbern, um bislang wortloses Glück zu entdecken, sondern die kleinen alltäglichen Glücksmomente mit neuen, eigenen Vokabeln belegen. Streichigkeit: der Genuss, perfekt temperierte Butter anstrengungslos auf einem Brötchen verteilen zu können. Sprudelresonanz: der Energieschub beim Anblick einer Wasserfontäne. Kraulig: der unbezwingbare Reflex, einem Hund die Ohren zu puscheln, sobald er einem den Kopf aufs Knie legt. Momente wie meinen Tankstellentriumph nenne ich bis auf Weiteres: das Uffhurra.