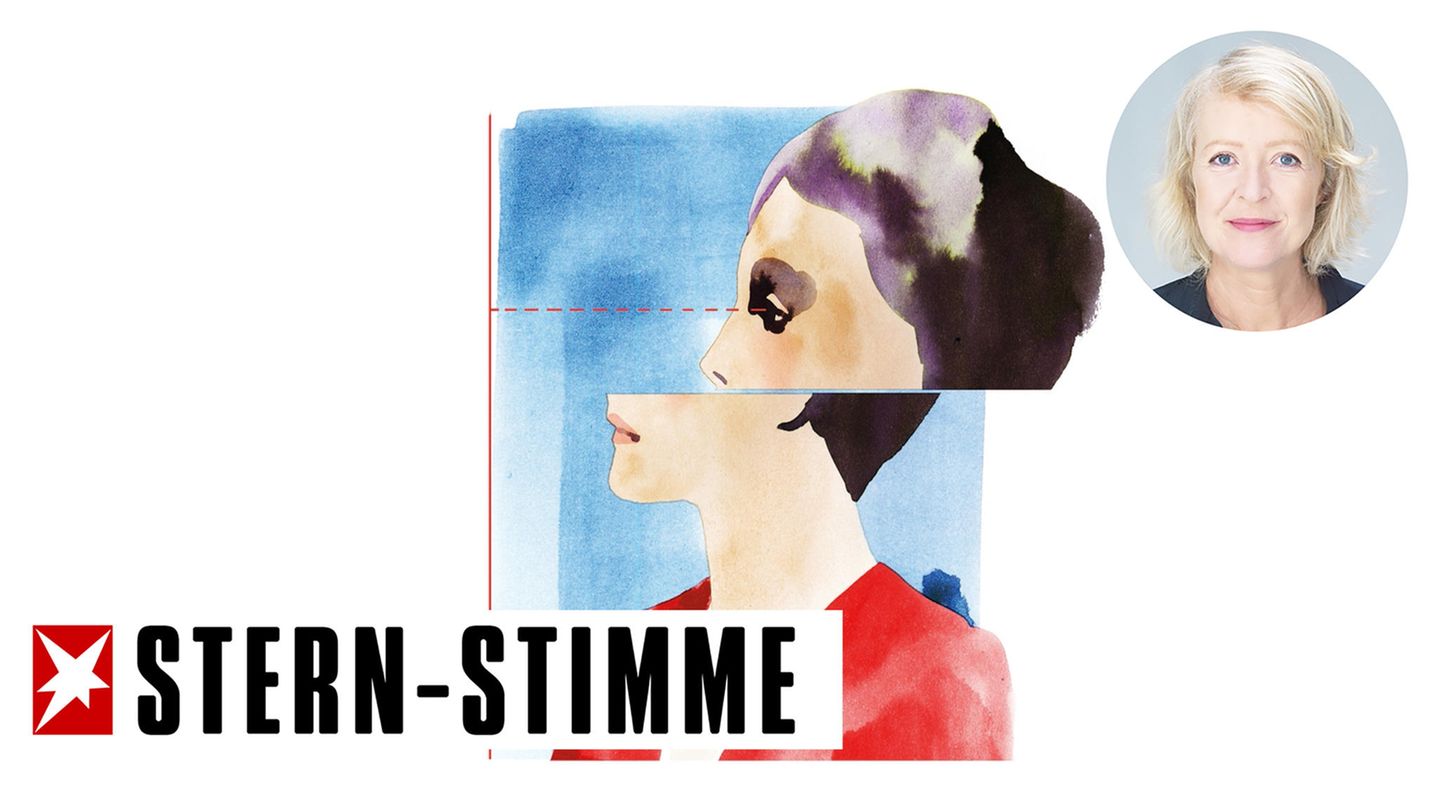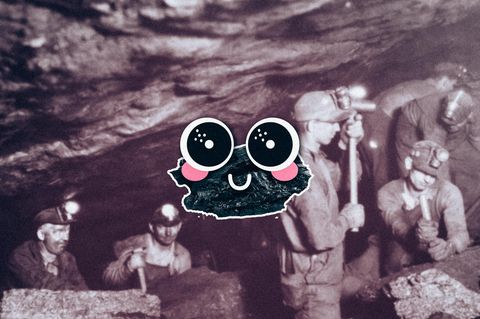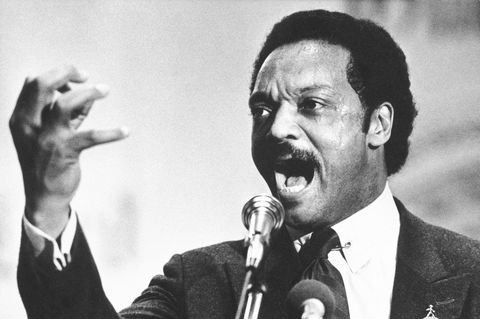Es gibt einen Begriff aus der Umweltforschung, über den ich gerade viel nachdenke: shifting baselines. Geprägt hat ihn der Meeresbiologe Daniel Pauly, er beschrieb damit das Phänomen, dass sich die Definition, was beispielsweise ein "normaler" Fischbestand sei, von Generation zu Generation verschiebe, weil das Wissen darüber, was vor Jahrhunderten üblich war, einfach verloren gegangen ist. Jede Forschergeneration setze einen neuen Referenzpunkt, gegen den die Entwicklung abgeglichen wird, und konstruiert eine neue Normalität, unmerklich verschoben. Das gilt nicht nur für Wissenschaftler, sondern für jeden auf der Welt: Das Artensterben beispielsweise ist für kaum jemanden wirklich persönlich spürbar – okay, vor 50 Jahren haben mehr tote Viecher an der Windschutzscheibe geklebt, aber sonst? Und dass die Sommer wärmer werden – ist doch herrlich!
Meike Winnemuth: Um es kurz zu machen
Meike Winnemuth schreibt Kolumnen, seit sie Buchstaben kennt, seit 2013 auch für den stern. Lange hatte sie einen kolossalen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Autoren, die 900-Seiten-Wälzer hinkriegen. Inzwischen hat sie sich damit abgefunden, dass sie eine Textsprinterin mit Kurzstreckenhirn ist und bekennt sich zum norddeutschen Motto "Nicht lang schnacken". Wenn sie sich dann allerdings doch mal zu einem richtigen Buch quält, wird das verrückterweise gleich ein Bestseller wie ihr Reisebuch "Das große Los. Wie ich bei Günter Jauch eine halbe Million gewann und einfach losfuhr".
Das Phänomen der shifting baselines, der kollektiven Wahrnehmungsverschiebung, lässt sich natürlich prächtig auf nahezu alles anwenden, was man in Gesellschaft und Politik beobachten kann. Veränderungen schleichen sich millimeterweise ins Bewusstsein (wenn überhaupt); was vorvorgestern noch undenkbar war, ist heute völlig selbstverständlich. Was normal ist, definiert sich stetig neu.
Die ständig wechselnde Definition von Normalität
Meine eigenen baselines shiften von Jahr zu Jahr schneller, so scheint es mir. Ich bin immer bereiter, alles mögliche für normal zu halten. Das meiste ist ja auch völlig egal: Dass die Mädchen sich Augenbrauen mit einem schwarzen Edding auf die Stirn malen (und wenn wir schon bei Stirn sind: die sturmfest festgezurrten Gesichter von Dieter Bohlen und Carsten Maschmeyer), die immer unsäglicheren Namen von Backwaren (Kartöpfelchen, Dinkelkrusti, Fanblock, Körnerdieb, Zimtwuppi, Bread Pitt – ich deute inzwischen nur noch hin und sage: "Davon bitte zwei") und all die anderen seltsamen Begleiterscheinungen des Alltags – geschenkt. Kann gern normal sein, es richtet wenigstens keinen Schaden an.
Schlimmer ist der Gewöhnungseffekt, wenn es eine Nummer größer und damit gefährlicher wird. Mit jeder Unterhausabstimmung findet man das Brexit-Chaos normaler. Man rechnet bereits mit dem Irrsinn, er ist erwartbar und damit normal. Die Steuermoral der Milliardenkonzerne, die Fuck-you-Haltung der Autoindustrie, der immer selbstverständlichere Gebrauch von Nazi-Ausdrücken wie "Lügenpresse" – man winkt inzwischen nur noch ermattet ab. Kennt man, ist halt so, wat willste machen. Die Erregungsbereitschaft lutscht sich kontinuierlich ab, das Wundern hat man schon lange eingestellt. Niemand regt sich mehr ernsthaft über eine weitere Twittermeldung von Donald Trump auf. Achselzucken, weiter – regelrecht dankbar, dass der Mann bislang keinen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Zur shifting baseline gehört eben auch, das Schlimmste zu erwarten und beim Eintritt des Zweitschlimmsten erleichtert zu sein.
Man arrangiert sich stetig, dank shifting baselines
Die menschliche Gabe, sich mit Dingen zu arrangieren, die man nicht ändern kann, und die Geschmeidigkeit, sich auf neue Entwicklungen einzustellen, ist eigentlich ein Gottesgeschenk. Man würde schier verrückt werden, wäre es anders. Aber ich stelle fest, dass die Verschiebungen im Referenzsystem nicht mehr schleichen, sondern galoppieren. 26 Prozent der jungen Erwachsenen im Osten und 23 Prozent im Westen finden laut einer Umfrage im Februar, dass es "einen starken Führer" geben sollte, "der sich nicht um Parlamente und Wahlen kümmern muss" . Weniger als die Hälfte der Befragten mochten dieser Aussage "überhaupt nicht zustimmen" . Neue Normalität? Ernsthaft? Lange hat mich nichts mehr so erschreckt.