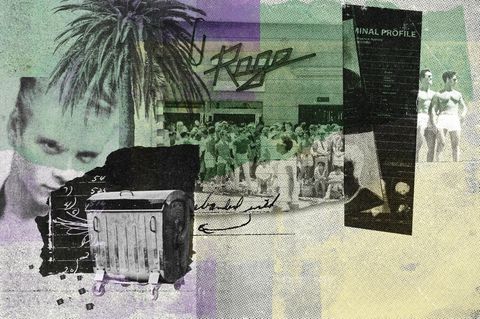Sanft wellen sich die Ebenen, tief klaffen die Einschlagskrater. Vulkankegel und mächtige Gebirge ragen empor - die Steinwüste erstreckt sich bis zum Horizont. Der Fels glüht dunkelrot, 480 Grad ist er heiß. Wo es auf den Berggipfeln kühler wird, liegt Schnee aus Blei- und Wismutsulfid. Ringsum verdunkeln dicke Schwefelsäurewolken den Himmel. Nur milchig dringen Sonnenstrahlen durch, tauchen alles in gespenstiges Licht. Hoch oben in der Atmosphäre toben Orkane, und immer wieder zucken Blitze durch den Dunst.
Die unwirtliche, geheimnisvolle Welt liegt in unserer kosmischen Nachbarschaft - auf dem Planeten Venus. Jetzt soll sie, insbesondere ihre Gashülle, so genau erkundet werden wie nie zuvor. Am Dienstagmorgen wird, wenn alles gut geht, die Esa-Sonde "Venus Express" in eine Umlaufbahn um die Himmelskugel schwenken.
Seit dem 9. November vergangenen Jahres ist das High-Tech-Paket unterwegs, eine russische Sojus-Rakete hat das 82 Millionen Euro teure europäische Forschungslabor ins All geschossen. Aus dem Orbit wird es den Planeten ausspähen - mit Hilfe einer Batterie von Detektoren und Sensoren sowie einer Kamera an Bord. "Wir erwarten eine Fülle von Daten", sagt Andrea Accomazzo, Spacecraft Operations Manager der Mission vom europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt, "schon einen Tag nach dem Einschwenken soll Venus Express die ersten zur Erde schicken."
Mehr Infos im Internet
www.esa.de Über die Website geht es zum "Venus Special" mit zahlreichen Informationen zum Planeten und der Mission
Ein Venustag dauert 117 Erdentage
Die Sonde wird ein Objekt inspizieren, das nach dem Mond das hellste am nächtlichen Firmament ist und von Himmelskundlern auf den Namen der römischen Göttin der Liebe getauft wurde. Ein mondloser Planet, nach Merkur der zweitnächste zur Sonne. Er ist so groß wie die Erde, die auf einer "nur" rund 40 Millionen Kilometer weiter äußeren Bahn um das Zentralgestirn zieht.
Doch er rotiert deutlich langsamer um sich selbst als unsere Kugel: 117 Erdentage dauert ein Venustag. Und dabei steht unser Nachbar im Vergleich zum Globus und den anderen Planeten des Sonnensystems auch noch auf dem Kopf - wahrscheinlich, so die Theorie der Astronomen, hat einst ein Crash mit einem anderen Himmelskörper die Achse gekippt.
Nach zwei Stunden schmolz die Apparatur
Der Erkundungsflug der Esa-Sonde ist nicht die erste Expedition zur Venus. Insgesamt 22 Missionen, in der Mehrzahl sowjetische, nahmen seit 1961 Kurs Richtung Nachbar und sammelten zahlreiche Daten. Sogar Lander gingen nieder, wie 1982 die sowjetische Sonde "Venera 13". Gut zwei Stunden lang funkte sie Fotos und Messwerte - dann schmolz die Apparatur. Die besten bis heute verfügbaren Karten und gestochen scharfe Aufnahmen von der Venusoberfläche lieferte die US-Sonde Magellan, die ab August 1990 den Planeten durch die Wolken hindurch mit Radar abtastete, bis sie im Oktober 1994 in seiner Atmosphäre verglühte.
Trotz all der Stippvisiten ist das Wissen über unser himmlisches Nebenan noch immer dürftig - dem soll nun Venus Express abhelfen. So ist beispielsweise unbekannt, ob dort immer noch Vulkane speien. Auf alle Fälle grollten und spuckten einst zahlreiche Feuerberge. Und vor etwa 600 Millionen Jahren muss es gar zu gigantischen Ausbrüchen gekommen sein. Fast die gesamte Oberfläche ist mit Lavaströmen bedeckt, und Datierungen zeigen, dass damals die Landschaft entstanden sein muss.
Wahrscheinlich, so spekulieren Planetenkundler, war das Desaster die Folge eines immensen Hitzestaus im Inneren der Kugel. Denn die Venus, das zeigten die Bilder von "Magellan", besitzt offensichtlich keine Kontinentalplatten wie die Erde. So aber kann die Wärme, die im Zentrum eines Planeten entsteht, nicht durch Verschiebungen der Schollen abgeführt werden. Es kommt zur Masseneruption.
"Das könnte sich wiederholen", sagt Ralf Jaumann vom Berliner Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, "alle paar hundert Millionen Jahre kann es zu solch einer Katastrophe kommen." Der Geologe und sein Team gehören zu den Wissenschaftlern, die Detektoren von Venus Express entwickelt haben und die Daten der Sonde auswerten. Mit den Instrumenten sollen Hitzepunkte auf der Venus aufgespürt werden, durch die sich noch tätige Vulkane verraten würden.
Enormer Treibhauseffekt
Die Häufigkeit der Eruptionen hat Folgen für die Atmosphäre des Planeten. Die Vulkane nämlich stoßen Gase aus, die die höllische Dunstglocke der Venus erzeugen. Sowohl Schwefeldioxid, das jene sauren Wolken bildet, die in 50 bis 70 Kilometer Höhe als dichter Schleier jeden Blick für ein irdisches Teleskop versperren, als auch Kohlendioxid (CO2) - und das in Massen. Zu 97 Prozent besteht die Atmosphäre daraus.
Das dichte Gas erzeugt auf der Oberfläche einen Druck von rund 90 Bar, so viel herrscht auf Erden in 900 Meter Meerestiefe. Die hohe CO2-Konzentration sorgt zudem für einen enormen Treibhauseffekt. So dringt die energiereiche Strahlung der Sonne zwar in die Gashülle ein, bleibt aber in ihr gefangen und gibt dort ihre Energie ab. Die Folge: Die Glocke ist aufgeheizt auf mörderische 480 Grad Celsius.
Vor allem das Funktionieren dieses Backofens soll Venus Express analysieren. "Da haben wir noch eine ganze Menge offene Fragen", sagt Jaumann, "zum Beispiel: Welche genaue chemische Zusammensetzung haben die einzelnen Schichten der Gashülle, und wie zirkulieren sie? Warum umrunden die Wolken den Planeten schneller, als er selbst rotiert? Wie spielt sich der Treibhauseffekt ganz genau ab, und wie entwickelte er sich? War es vielleicht einst dort sogar noch heißer?"
Erkenntnisse, die auch auf der Erde nutzen
Die Wissenschaftler haben ein solch großes Interesse an der Venus-Hülle, weil sie davon überzeugt sind, dass sie auf unserem Nachbarn die Atmosphäre eines Planeten im Urzustand studieren können. Auch die Lufthülle der Erde nämlich bestand aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich vor allem aus CO2. Die auf unserem Globus lebenden Organismen haben es ihr jedoch im Laufe der Zeit entzogen und es beispielsweise in ihre Kalkskelette eingelagert. Auch in Kohle und Öl etwa ist der Kohlenstoff gespeichert.
Wenn der Mensch heute diese fossilen Energieträger in großem Maßstab verbrennt, werden Teile davon wieder freigesetzt. Wie gravierend die Auswirkungen sind, wie stark sie den Klimawandel befördern, wird unter Forschern seit Jahren heftig diskutiert. Auf alle Fälle beobachten sie auch auf der Erde einen zunehmenden Treibhauseffekt.
Gibt es Spuren von Leben?
Die Esa-Sonde soll auch die mysteriösen dunklen Flecken inspizieren, die in früheren UV-Aufnahmen in den Wolken entdeckt wurden. Immerhin glaubt der deutsche Astrobiologe Dirk Schulze-Makuch, der an der Washington State University forscht, dass es Spuren von Leben auf dem sonst so lebensfeindlichen Planeten geben könnte. In den Wolken nämlich sei es milde 30 bis 80 Grad warm, außerdem herrsche dort ein Druck wie auf der Erdoberfläche. Also könnten in dieser Umgebung exotische Mikroben prima gedeihen.
Viel Gehör fand seine These unter den Venusforschern indes nicht. Allenfalls in einer ganz frühen Lebensphase des Planeten, so räumen sie ein, als es dort möglicherweise mal kühler und noch nicht alles Wasser ins All verdampft war, könnten sich einfachste Lebensformen gebildet haben, die aber heute ausradiert sind.
Zunächst einmal 500 Tage lang soll nun Venus Express die rätselhafte Welt im All erkunden. "Wenn es die wissenschaftlichen Ergebnisse rechtfertigen", sagt Spacecraft Operations Manager Andrea Accomazzo, "können wir die Expedition allerdings noch mal um dieselbe Zeitspanne verlängern." Um all die Daten zu verarbeiten, die das fliegende Labor zur Erde sendet, werden die Wissenschaftler dann Jahrzehnte benötigen.