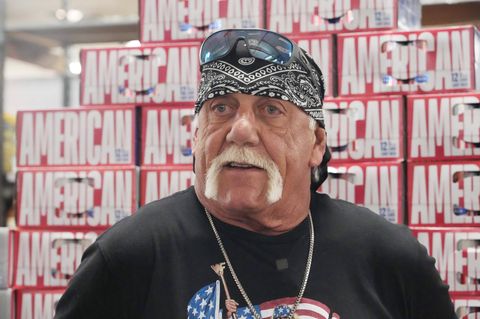Eine Mutter und ein Vater, die ihr Kind verhungern lassen, wie ist so etwas möglich?
Wenn Eltern ihr Kind verhungern lassen, dann fehlt nicht nur die elterliche Sorge, dann haben sich da auch massive Aggressionen entladen. Anscheinend haben sie alles Schlechte in das Kind hinein projiziert oder im Kind die Ursache für ihr Elend gesehen.
Ist das normal?
Zunächst einmal ist es ein normaler Mechanismus, wenn wir in andere Menschen, insbesondere diejenigen, die wir lieben, unsere Wünsche, Hoffnungen oder Ideale hinein projizieren. Aber wir können auch alle negativen Gefühle in andere projizieren, dann werden aus den göttlichen Wesen gehasste Menschen, die man bekämpfen muss, um seine eigene Haut zu retten. Misshandelnde Eltern erleben sich selbst oftmals als Opfer ihrer Kinder, denen sie wehrlos ausgesetzt sind.
So wehrlos, dass Grundinstinkte, wie das Füttern der Jungen, die jedem Tier eigen sind, ausgeschaltet werden?
Ja, aber in solch schweren Fällen sind diese menschlichen Sorgefähigkeiten in einer frühen Eltern-Kind-Beziehung schwer verletzt oder gar zerstört worden. Die Täter von heute waren häufig die Opfer von gestern, die ein Martyrium überlebt haben. Sie haben damals gelernt, ihre Ängste, Gefühle oder ganze Körperregionen abzuspalten, um zu überleben. Diese Dissoziationen können so lange weitgehend unauffällig bestehen bleiben, bis sie selber wieder Eltern werden, dann wird die alte Zerstörung der Eltern-Kind-Beziehung neuerlich wirksam. Wenn die Eltern von Jessica ihrer Tochter kurz vor ihrem Tod in die Augen gesehen haben, dann haben sie in die Augen einer alten Frau gesehen, weil das Fett im Augenhintergrund als letztes abgebaut wird. Diesen Anblick zu ertragen ist nur mit massiven Abspaltungen möglich und dies verweist auf eigene Traumaerfahrungen. Damit will ich nichts entschuldigen, sondern nur verstehen, wie es zu solch einer Unmenschlichkeit kommen konnte.
Was für traumatische Erfahrungen können das gewesen sein?
Wir unterscheiden im Wesentlichen drei Formen der Kindeswohlgefährdung: Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Dabei ist der sexuelle Missbrauch die schwerste Form, weil er die Vernachlässigung kindlicher Bedürfnisse und die Misshandlung des Kindes einschließt. Jessicas Mutter ist anscheinend in einer Familie groß geworden, in der es Suchtprobleme und sexuelle Grenzverletzungen gab. Wenn die Sucht chronisch wird, dann verflüssigt sich die Nahrung. Dabei haben Beschaffung und Konsum des Suchtmittels absoluten Vorrang in der Familie, sodass die Kinder unterversorgt sind und schlicht nichts zu essen bekommen. Kommen sexuelle Grenzverletzungen hinzu, erlebt solch ein Kind absolute Wertlosigkeit: es wird nicht genug geliebt, um zu essen zu bekommen und es wird zusätzlich als ein Instrument zur sexuellen Befriedigung der Erwachsenen missbraucht. Das ist unmenschlich. Diese Kinder können nur überleben, wenn sie sich gefühllos machen.
Und die Eltern von Jessica könnten ihr Kind im Nebenzimmer in ähnlicher Weise ausgeblendet haben?
Ja. Eltern zu sein, bedeutet immer auch die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen. Wenn Eltern sich mit solchen traumatischen Erfahrungen in ihre Kinder hinein versetzen, die Welt wieder mit den Augen des Kindes sehen, dann drohen auch die alten Erlebnisse wieder erinnert zu werden, und dann muss noch stärker verdrängt und abgespalten werden.
Wenn jemand misshandelt oder missbraucht wird, so würde man doch annehmen, dass sich dieser gerade deshalb anders verhält, weil er erfahren hat, wie verletzend das ist.
Das ist eine weit verbreitete falsche Annahme. Wir alle haben uns als junge Menschen vorgenommen, vieles anders zu machen, wenn wir selbst mal Eltern sein werden. Und dann entdecken wir uns plötzlich dabei, wie wir im Kinderzimmer stehen und zu unseren Kindern in dem gleichen Tonfall und auf die gleiche unerträgliche Weise sprechen, wir es damals unsere Eltern getan haben und wie wir niemals sein wollten. Wenn man dies erkennt und korrigieren kann, gehört so was zu den Sternstunden der Elterlichkeit. Der kulturelle Fortschritt muß hart erarbeitet werden und anscheinend greifen wir in Stressituationen eher auf die alten Folien zurück.
Und das geht im Extremfall so weit, dass jemand dieselbe Brutalität entwickelt?
Ja. Wenn beispielsweise eine Mutter ihr Kind misshandelt, dann erscheint der Fall äußerlich klar. Das innere Szenario kann jedoch ganz anders aussehen, da stellt sich psychologisch die Frage: wer misshandelt hier wen oder was? Ich habe es häufig erlebt, dass Mütter vor allem diejenigen Kinder misshandeln, die sie besonders lieben. Sie identifizieren sich mit dem Kind, projizieren eigene positive und negative Selbstanteile in diese Kinder und schlagen im Kind ihre abgewehrten Selbstbilder. In der Misshandlung eines Kindes kann psychologisch gesehen auch ein Hilferuf an die eigenen Eltern stecken: Helft mir, ich schaffe das mit dem Kind nicht mehr! Oder im Kind wird ein anderer Mensch misshandelt, vielleicht der verhasste leibliche Vater des Kindes. Was macht die Mutter in Darfour, wenn sie in die Augen ihres Kindes sieht und dabei den Mann sieht, der sie vergewaltigt hat, was macht sie mit ihren Aggressionen?
Ist diese Vernachlässigung nicht auch etwas, das aus einem Milieu erwächst?
In einem belasteten sozialen Milieu gibt es häufig weniger Ressourcen, da können sich Sozialhilfeempfängerinnen keine Tagesmütter oder Au Pair Mädchen leisten. Aber das bedeutet nicht, dass die Schichtzugehörigkeit das Misshandlungsrisiko bestimmt. Wir finden solche Kindesmisshandlungen in allen sozialen Schichten bis hin zur Wohlstandsverwahrlosung der Kinder.
Was kann man tun?
Hinsehen, verstehen und Hilfsangebote leisten. Traumatisierungen haben die Tendenz, sich über Generationen fort zu pflanzen, wenn man diese intergenerationellen Muster nicht unterbricht. Am besten ist es, wenn man diese traumatisierten Kinder dann erreicht, wenn sie selber Kinder bekommen, möglichst schon in der Schwangerschaft und ihnen dann lebensnahe Hilfsangebote macht, die es ihnen ermöglicht, die kindlichen Entwicklungsbedürfnisse zu lesen und zu befriedigen. Das ist es, was wir in unserem Forschungsprojekt für das Bundesfamilienministerium zum Thema "Frühe Hilfen für Kinder und ihre Familien" versuchen.
Das Gespräch führte Kuno Kruse