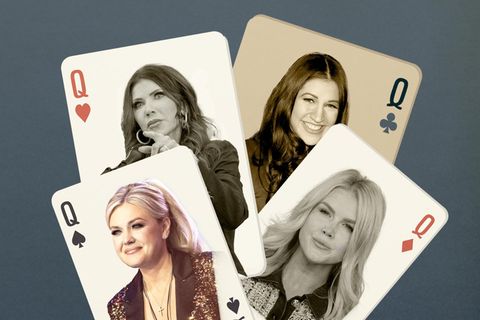Selbst wenn der Euro, irgendwie, überlebt: Das Europa, das wir kannten, ist gescheitert.
Nein, ich bin kein Euro-Kritiker der ersten Stunde. Noch vor knapp zehn Jahren habe ich auf ihn angestoßen, in einem Hotelzimmer in New York. Meine damalige Lebensgefährtin - eine Finnin - und ich hatten uns eigens eine kleine Flasche Champagner gekauft und dann am 31.Dezember 2001 um Punkt 18 Uhr vor den Fernseher gesetzt und auf CNN geschaltet. Wir waren ein bisschen enttäuscht, weil der US-Sender die mitternächtliche Feier in Brüssel zu Ehren der neuen Scheine und Münzen nur ganz kurz im Programm hatte.
Wir feierten, obwohl wir wussten, dass ein Großteil unserer deutschen und finnischen Mitbürger gegen die neue Kunstwährung waren. Aber wir selbst waren keine normalen Mitbürger. Wir pendelten zwischen Brüssel und Helsinki, dazwischen mal ein paar Tage in Berlin oder ein Wochenende in Paris. Wir lebten so wie die kosmopolitische EU-Elite, die das Projekt Währungsunion vorantrieb. Für uns war es enorm praktisch, nicht mehr ständig mit vier oder fünf Währungen jonglieren zu müssen. Der Euro, das war Modernität.
Doch nun, zehn Jahre später, ist der Kollaps der Währung, die wir damals gefeiert haben, keine nur theoretische Möglichkeit mehr. Selbst falls der Euro gerettet wird, werden die Kosten gewaltig sein. Jedes mal, wenn wir heute zwischen Helsinki und Berlin telefonieren, fragen wir uns, warum wir vor zehn Jahren so gutgläubig waren. Die skeptischen Bürger hatten recht, und wir haben uns geirrt. Und gerade als Journalisten müssen wir uns nun fragen, warum wir nicht aufmerksamer und kritischer waren.
Als ich vor zehn Jahren auf den Euro anstieß war ich kein naiver Euroromantiker mehr. Zwei Jahre arbeitete ich damals schon als Brüsseler stern-Korrespondent und wusste, wie unkontrolliert und selbstgefällig große Teile der EU-Bürokratie agierten. Vier Jahre zuvor beim Amsterdamer EU-Gipfel hatte ich bereits verfolgt, wie Kanzler Helmut Kohl und Finanzminister Theo Waigel einen Stabilitätspakt light akzeptierten. Viele warnten damals, der Pakt werde nicht funktionieren, weil die Sanktionen gar nicht anwendbar seien.
Aber mein Zutrauen in den Euro erschütterte das zunächst nicht. Gewiss, viele Experten vor allem in den USA aber auch ein Großteil der deutschen Volkswirtschaftsprofessoren hatten geunkt: Das ganze Konstrukt werde nicht funktionieren. Es sei ohne politische Union „zum Scheitern verurteilt“, postulierte Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl schon 1988 und auch ich hatte das gelesen.
Aber das machte mich nicht irre im Vertrauen in meine Regierung. Würde sie dieses Abenteuer wirklich wagen, wenn es ein ernstes Risiko gäbe?
Ich hätte Zweifel bekommen können beim Gipfel in Brüssel 1998, auf dem sich Kohl von den Franzosen eine verkürzte Amtszeit des ersten EZB-Präsidenten Wim Duisenberg abhandeln ließ – zu Gunsten des Franzosen Jean-Claude Trichet und zu Lasten der Unabhängigkeit der Zentralbank. Später interviewte ich sowohl Duisenberg wie Trichet persönlich, schrieb ausführliche Porträts über beide und fand, dass Trichet eigentlich der solidere der beiden sei.
Als ich 2001 über Duisenberg recherchierte, interviewte ich aber auch dessen einstigen Freund Harry Mulisch. Der berühmte Schriftsteller verriet mir in seiner Wohnung nahe dem Amsterdamer Leidseplein die Zweifel, die er an der Währungsunion hatte: „Die Deutschen, das sind tüchtige Leute. Aber wie ist das mit den Italienern? Wer kommt jetzt noch dazu?“
Vielleicht klang mir das damals ein bisschen engstirnig, aber verstehen konnte ich Mulischs Fragen trotzdem. Dass Italien nicht zuletzt unter dem Druck der Industrie in Frankreich und Teilen Deutschlands aufgenommen worden war, die bei einer kleineren Nord-Union die Konkurrenz billiger Lire-Produkte fürchteten – das war mir nicht entgangen. Aber konnte es sein, dass ein Schriftsteller das Risiko klarer sah als die Experten? Das glaubte damals nicht mal Mulisch: „Wenn Duisenberg dafür ist – wie soll ich es in Frage stellen?“, sagte er mir.
Gemeinsam hatten die EU-Regierungschefs im Jahr 2000 entschieden, nun auch Griechenland in die Währungsunion aufzunehmen. Einige CSU-Abgeordnete stimmten im Europaparlament zwar dagegen, aber das bewegte mich nicht weiter. Der damalige Finanzminister Hans Eichel (SPD) verteidigte sich später damit, dass die EU-Kommission die Aufnahme ja geprüft und gebilligt habe. In der Kommission war dafür unter anderem das damals wenige bekannte Statistikamt Eurostat zuständig. Dort hatten sie die griechischen Zahlen geprüft – und dabei geschlampt und Alarmzeichen übersehen, wie die EU-Kommission selbst vier Jahre später offiziell einräumte.
Dass bei Eurostat vieles im Argen war, begann ich ab 2002 in einer Serie von Artikeln zu enthüllen: Schwarze Kassen, unzuverlässige Zahlen und auffällig viele Forschungsaufträge an griechische Firmen, sogar für den Patensohn eines griechischen Eurostat-Direktors. All das führte schließlich 2003 dazu, dass die Kommission die gesamte obere Führungsebene des Amtes versetzte. Da war es jedenfalls für Griechenland zu spät.
Ab 2002 verfolgte ich in Brüssel auch die erfolgreichen Versuche der Regierung von Gerhard Schröder und Joschka Fischer, den Stabilitätspakt zu lockern - indirekt unterstützt ausgerechnet von dem italienischen Kommissionspräsidenten Romano Prodi, der den Vertrag als Stupiditätspakt verunglimpfte. Metaphorisch gesprochen geschah Folgendes: Im gemeinsamen Währungsgebäude, das bereits windschief konstruiert war, entfernte man nun tragende Wände.
Das inspirierte meinen Kollegen Andreas Oldag und mich zu einem kleinen Science-Fiction-Szenario. In unserem 2003 veröffentlichten Buch über das „Raumschiff Brüssel“ spielten wir auch einen möglichen Kollaps der Euro-Zone durch, für das Jahr 2010 (irrtümlich sagten wir die Regentschaft eines Bundeskanzlers Roland Koch voraus). Damals, also im Jahr 2003, war längst offensichtlich geworden, dass die Mitgliedsstaaten jederzeit bereit waren, aus nationalem Interesse die gemeinsamen Regeln zu umgehen. Und die EU-Kommission war zu unwillig und zu schwach, um diese Regeln und damit den Euro zu verteidigen.
„Am Ende muss sich keiner verantworten, wenn etwas schief geht“, resümierten wir 2003 das europatypische System der kollektiven Entscheidung. Für das Buch wurden wir in einigen deutschen Zeitungen sehr gescholten. Wir bedienten die Stammtische, wurde uns vorgeworfen.
EU-Kommission und Bundesregierung taten diese Prognose als absurd ab. In fast allen großen Zeitungen stimmten die Finanzexperten ein und verurteilten unsere angebliche Panikmache in scharfen Worten. Von der Politik und Trichets EZB ermutigt kauften Banken und andere Anleger weiter fröhlich südeuropäische Staatsanleihen und vergrößerten so die Risiken in ihren Bilanzen.
„Damals wäre noch Zeit gewesen“, stöhnen heute in Brüssel diejenigen klugen Leute, die es auch dort gibt. Aber auf sie hörte man nicht. Und auch ich verfolgte das Thema nicht weiter.
Heute sollten wir alle uns fragen, warum wir es haben so weit kommen lassen. Gewiss, es gab und gibt gute Argumente für den Euro. Aber inzwischen weiß jeder, dass die frühen Kritiker recht hatten, die auf die Schwächen der Währungsunion hinwiesen. Auf Schwächen, die man hätte vermeiden können.
„Die Währungsunion ist gemacht worden in dem guten Glauben, das wird schon klappen“, bekannte Angela Merkel gestern in schöner Offenheit in der ARD. Moderator Günther Jauch vermied es höflich sie zu fragen, mit welchen Gefühlen und Gedanken sie denn als junge Ministerin in zwei Kabinetten des Kanzlers Kohl die Schritte zur Währungsunion gebilligt hatte.
Aber solche Fragen werden unsere Politiker beantworten müssen. In Deutschland sind das in erster Linie diejenigen bei CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen, die das kontinentale Großexperiment der Wird-schon-klappen-Währungsunion mitgetragen haben. Ein Experiment, bei dem sie sich gegenseitig sogar dafür feierten, dass sie es gegen den Willen der Mehrheit der Bürger durchgesetzt und fortgeführt hatten. Wie oft wurde Helmut Kohl noch bis in diese Tage dafür gepriesen, dass er beim Euro Führung gezeigt habe – gegen seine zögernden Mitbürger.
Doch zu Recht sagen wir den Griechen, dass sie die Verantwortung für ihre Probleme nicht auf die Politiker des Landes abschieben können. Diese wurden ja regelmäßig gewählt. Auch wir anderen Europäer haben regelmäßig mit überwältigenden Mehrheiten die Politiker derjenigen Parteien unterstützt, die uns in diese Krise geführt haben – auch wenn wir in Deutschland unter all den Pro-Euro-Parteien keine echte Auswahl hatten und die Brüsseler Bürokratie sich noch nie von zweifelnden Bürgern beirren ließ.
Wenn der Euro scheitert, scheitert Europa, wie Angela Merkel sagt? Das ist leider wahr. Gewiss, Europa wird nicht untergehen. Vielleicht überstünde sogar die Europäische Union einen Kollaps ihres Prestigeprojektes. Aber in den Augen der Welt wird es unser aller Scheitern sein – obwohl Politiker wie Gerhard Schröder, Angela Merkel und vor allem Helmut Kohl einen größeren Anteil haben als einige andere.
Gescheitert ist diese Politik übrigens auch dann, wenn der Euro gerettet wird. Natürlich muss man das Menschenmögliche tun, um das zu erreichen. Doch inzwischen drängt die Frage, ob die Rettung überhaupt menschenmöglich ist. So oder so wäre es wohl allen in Europa lieber gewesen, wir hätten diese Krise gar nicht erst erlebt – und im Rest der Welt, den wir mit unserer miserabel konstruierten Währungsunion nun in den Abgrund einer globalen Kernschmelze des Finanzsystems zu reißen drohen. Nebenbei: Wurde uns nicht immer versprochen, EU und Euro würden uns in der globalisierten Welt stärken?
Und es bleibt nicht beim gigantischen finanziellen Schaden, den sowohl Euro-Rettung wie – erst recht – Euro-Crash auslösen werden. Der Streit um die Verteilung dieser Kosten treibt jetzt schon Europa auseinander. Finnen, Niederländer und Deutsche wettern über faule Griechen oder Spanier. Die, zusammen mit Italienern und Portugiesen, werfen den Nordlichtern Hartherzigkeit und Geiz vor. Der Euro, den Angela Merkel immer noch als Friedensprojekt anpreist, spaltet den Kontinent. Euroskeptiker hatten das immer vorausgesagt.
Weil die Wut der Bürger – in Norden wie Süden - die deutsche und die europäische Politik lähmt, richten sich nun alle Blicke auf die Europäische Zentralbank. Alle wissen: Wenn im Gefolge eines griechischen Staatsbankrotts Italien ins Wanken gerät, dann hat nur die EZB die finanzielle Feuerkraft, den Euro zu retten.
Am Ende (oder kurz davor) sollen also Technokraten Milliarden (manche sagen: eine Billion) von Euro einsetzen, die im Verlustfall wir Steuerzahler ersetzen müssen. Wir Steuerzahler, die niemand fragen wird.
Einige besonders Gläubige, ausgerechnet auf der Linken, bejubeln diese Machtübernahme der Technokratie. Da wirken wohl die Reste eines deutschen Elitenkonsenses, bei dem man bereit sein musste, zu Gunsten Europas gelegentlich die Verteidigung von Grundwerten zu suspendieren. Also ja zur Demokratie – es sei denn sie kollidiert mit dem Wunsch nach mehr Europa.
Wirklich geholfen hat der EU das noch nie. Und die Mehrzahl der Bürger Europas ist weniger denn je bereit für den Sprung in den europäischen Glauben. Weitere Großexperimente wird sich die Politik nach dem Euro-Desaster über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, nicht leisten können.
Es ist ja richtig: Nur die politische Union könnte den Euro auf eine langfristig stabile Basis stellen. Was wir bräuchten, wäre eine europäische verfassungsgebende Versammlung, diesmal demokratisch gewählt.
Aber unsere Wird-schon-klappen-Europäer haben diese Perspektive erst mal ruiniert – und wir alle haben zugeschaut. Vereinigte Staaten von Europa? Träumt weiter.
Ja, es ist ein Jammer.