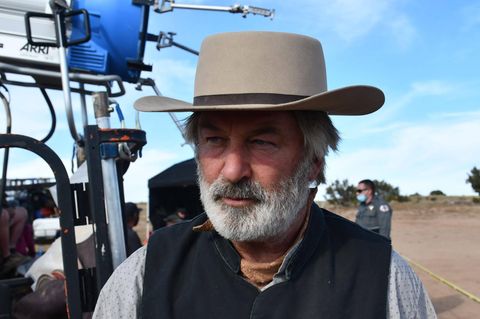Geübte Wiesn-Besucher tragen keine Taschen. Was durchaus empfehlenswert ist, denn was nicht herumbaumelt, kann auch nicht geklaut werden. Ein junges Pärchen auf dem Weg dorthin hat sich richtig fein gemacht. Er trägt ein blütenweißes Hemd und kurze Lederhosen, die Wollsocken stecken in schweren Tretern, die dunklen Haare sind gegelt. Sie präsentiert sich in einem gedeckten, sehr eng anliegenden Dirndl. Gottseidank ist der Stoff fest und der Reißverschluss auch. Aber der Rock ist kurz. Die schwer im Aufwind befindlichen Brauchtümler würden das als unverzeihlich monieren. Immer mehr, das ist dieses Jahr deutlich zu beobachten, setzt sich die traditionelle Tracht durch, da ist die Frau eingehüllt in lange Stoffbahnen. Sittsam und traditionsbewusst.
Wer sich die teure Trachtenverkleidung nicht leisten möchte, greift auf die Idealbekleidung Jeans zurück und setzt auf das hohe Wiesn-Erkennungssymbol Filzhut, der als Maßkrug gestaltet ist und seine Träger auf die Größe eines Basketballspielers hebt. Besonders Italiener seien dafür anfällig, heißt es bei den Verkaufsständen. Oder auf ein Lebkuchenherz, das um die Brust baumelt und dessen Schriftzug verkündet: "Ich hab’ Dich lieb". Das Lebkuchenherz tragen gern die älteren weiblichen Semester, die wiederum nicht so viel Duft verstrahlen wie jenes junge Pärchen aus der U-Bahn.
Da es ein trüber, stinknormaler September Nachmittag ist, füllt sich die Bahn erst auf der letzten Strecke zur Theresienwiese. In normalen Zeiten würde man die Tatsache, rempelfrei U-Bahn zu fahren, nicht als Privileg empfinden, aber in den zwei Münchner Wiesn-Wochen... da ist ein Stehplatz, der unangetastet bleibt, Gold wert. 3,3 Millionen Besucher, so konnte man lesen, haben das Volksfest dieses Jahr schon besucht, aber die erfolgsverwöhnte Festleiterin, Gabriele Weishäupl ist nur einigermaßen zufrieden. Auch, weil die Leute beim Geldausgeben offenbar mehr aufpassen, in den Festzelten wird nicht so viel verzehrt.
Mehr Bier, mehr Hendl, mehr Ochs
Die Attraktivität des Massenevents basiert nicht erst seit dem Rekordjahr 1985 auf kontinuierlichem Wachstum, sprich: Mehr Bier, mehr Hendl, mehr Ochs und Schwein, mehr Karussell und Geisterbahn. Sondern leider auch - das gehört wie der Teufel zum Lieben Gott - auf mehr Schlägereien und Zugedröhnten. Wie Trophäen müssen auch diese Zahlen dafür herhalten, dass es sich um das größte Volksfest der Welt handelt. Mit dieser Oktoberfest-Wiesn und ihren 239 Volltrunkenen zur Halbzeit waren Polizei und Helfer recht zufrieden. Massenhafte Schnitt- und Platzwunden und vor allem die zahlreichen Kreislaufbeschwerden sind beim vorher wochenlang herbeigebeteten Spätsommerwetter zwangsläufig normal.
Keines der 173 stattgefundenen Feste des Erfinders, Kronprinz Ludwig gingen vonstatten, ohne dass jemand seinem Gegenüber eine Maß über den Schädel schlug. Dieses Jahr war es ein Ordner, der einen Bierkrug abkriegte, als er einen Tischtänzer an seinem Auftritt hindern wollte. Der Tänzer tobte daraufhin noch mehr und biss dem Ordner ins Bein. Ein weiterer, schlagzeilenträchtiger Zwischenfall: Vor einer Herrentoilette spielen zwei Männer Trompete. Zwei weitere kommen hinzu und bringen die Musikanten mit ihren Maßkrügen zu Fall. Die Folge sind Schulterverletzung und Kieferbruch bei den Attackierten, auch das eine alltägliche Wies’n-Rauferei.
Die Wiesn als Krankheitskategorie
Einen klassischen Oktoberfest-Besucher von 2006 erkennt man daran, dass er in der strammen Lederhose ein Handy stecken hat, das beim Bummel durch die Straßen zwischen den Schaubuden, Festzelten, Autoskootern, Achterbahnen, Kettenfliegern, Riesenrädern und Wildwasserbahnen stets griffbereit ist. Weshalb nicht verwundert, dass die Zahl der abhanden gekommenen Mobiltelefone zur Halbzeit bereits bei 70 lag, gleichauf mit der Zahl der Schirme. Ein klassischer Oktoberfest-Besucher zahlt - ohne zu maulen - zwischen 6,95 und 7,50 Euro für eine Maß Bier.
Ein Liter ist das absolute Minimum. Soweit sich eine Stimmung erspüren lässt, war der typische Besucher dieses Jahr gar nicht so überschwänglich, dass die These unwiderruflich ist, bei der Wies'n handle es sich um ein "rauschhaftes, dionysisches Fest mit archaischen Riten", wie eine Psychologin schrieb. Auch wenn es für Wissenschaftler reizvoll sein mag, dem Oktoberfest eine eigene Kategorie unter den Krankheiten einzuräumen, eine Art Oktoberfest-Sucht, sprechen dagegen Hinweise wie der des Oberbürgermeisters Christian Ude, die Atmosphäre sei heiter bis feierlich. Äußerungen von Standbesitzern sind verhaltener. "Es geht so", sagt ein Verkäufer am Stand für gebrannte Mandeln. "Nicht so der Renner", eine Kassiererin vor der Achterbahn.
Unzweifelhaft ist das Oktoberfest der Welt größter Stammtisch und damit ein Wirtschaftsfaktor für die Region. 3,2 Millionen Liter Bier wurden schon runtergespült, unzählige Brezen und 51 Ochsen vertilgt, die Stadtwerke profitieren von bisher 1,1 Millionen Kilowatt geliefertem Strom und 22.000 Kubikmetern Wasser. Das Rote Kreuz musste schon 17 Kinder einsammeln, die nach Mami oder Papi riefen.
Auch das: Prosecco aus Dosen
Einen Dämpfer bekam dieses Jahr die Promi-Etage. Energisch und prompt griff die Stadt gegen Versuche ein, die Wies’n zum Schauplatz von Produkt-Placement und Werbeaktionen zu machen. Selbst Paris Hilton musste in ihrem goldenen Dirndl bei einer Einzelhandelskette in einem Vorort Münchens auftreten anstatt im Hippodrom. Für Prosecco aus einer Bierdose konnte das prominente Blondchen überwiegend Hausfrauen aus Solln begeistern.
Mit oder ohne Paris: Am frühen Nachmittag ist es noch ziemlich friedlich auf der Wiesn, wenn man das überhaupt so nennen kann. Da tönt zwar aus allen Ecken "Hey Baby" oder "Marmor, Stein und Eisen bricht" oder irgendein bayerischer Marsch. Der Geräuschteppich reicht gerade, um festzustellen, wo man sich befindet. In dem Gewühl bestätigt sich, was die Organisatoren gesagt haben, dass es eine Hinwendung zum Traditionellen gebe. Man kann Bummler beobachten, die bei den vorüberziehenden Klängen bayerischer Marschmusik automatisch eine stramme Haltung einnehmen. Das ist dann aber vor der Einkehr ins Festzelt.