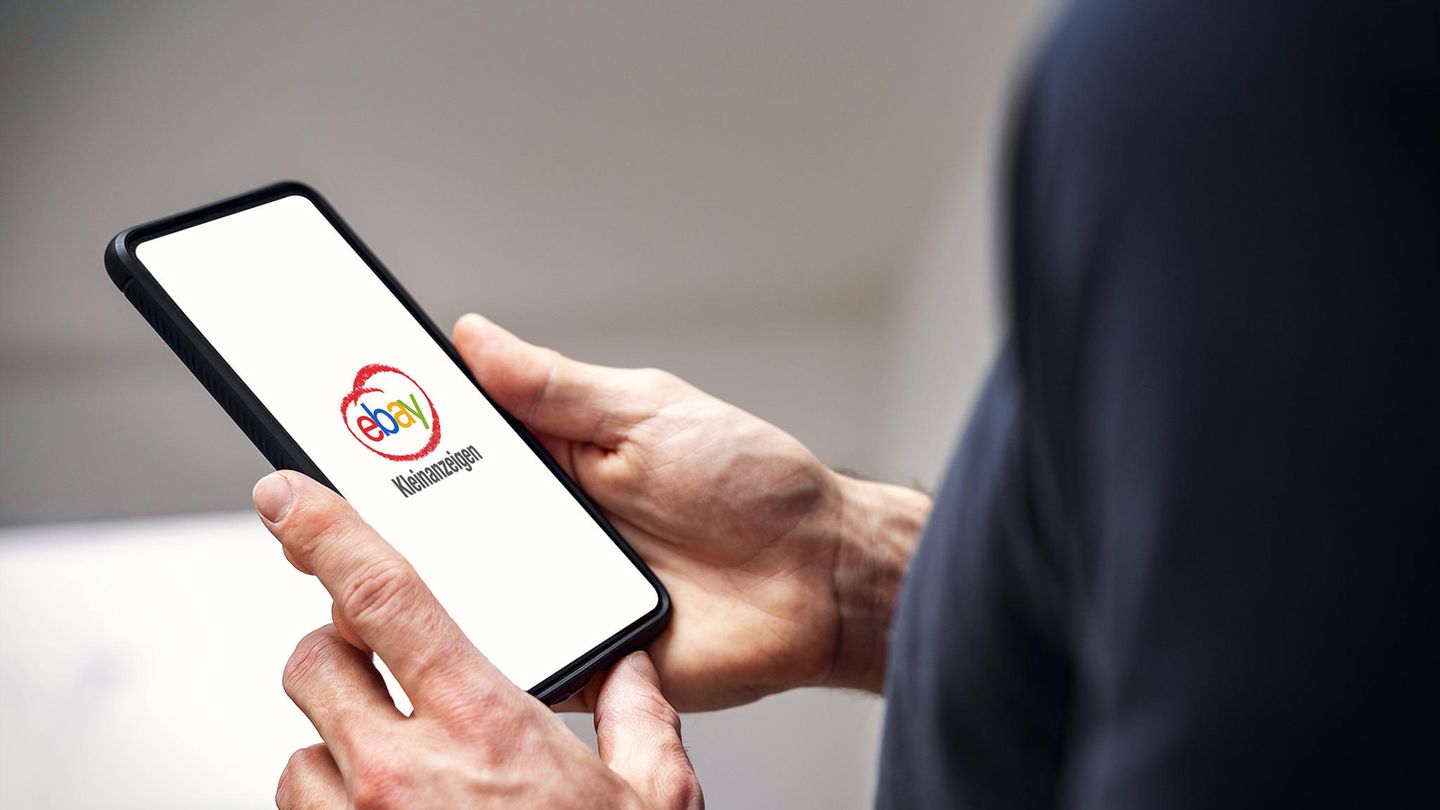Mit Verkäufen über Ebay Kleinanzeigen, Etsy oder Vinted verdienen sich viele Menschen ein paar Euro dazu. Doch nun sorgt ein neues Steuergesetz für Aufregung: Seit Anfang 2023 können auch vermeintlich kleine Privatverkäufer viel schneller in den Fokus des Finanzamts rücken. Denn Online-Portale sind nun verpflichtet, Daten der über die Plattform abgewickelten Verkäufe automatisch an die Steuerbehörden weiterzuleiten.
Obwohl die meisten privaten Verkäufe steuerfrei bleiben, sorgt das Gesetz für große Verunsicherung. "Bei uns melden sich seit Wochen viele verunsicherte Nutzer, dabei ist nur ein sehr kleiner Teil überhaupt betroffen", sagt Pierre Du Bois, Sprecher von Ebay-Kleinanzeigen. Auf dem Kleinanzeigenportal, das unabhängig von der früheren Konzernmutter Ebay agiert, tummeln sich jeden Monat Millionen private Käufer und Verkäufer.
Was ändert sich jetzt wirklich für (private) Verkäufer auf Online-Plattformen und wem drohen bald Steuerforderungen? Der Überblick.
Was besagt das neue Gesetz?
Seit dem 1. Januar 2023 gilt das Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG). Dieses besagt, dass Online-Portale dem Bundeszentralamt für Steuern Daten über Transaktionen auf ihrer Plattform melden müssen – und zwar nicht nur von professionellen Händlern sondern auch von Privatpersonen. Solche Daten konnten Steuerfahnder bei Verdacht auf Steuerbetrug auch bisher schon bei den Plattformen erfragen. Nun können sie noch leichter feststellen, ob ein Nutzer auf seine Einnahmen hätte Steuern zahlen müssen. Das Gesetz zielt vor allem auf professionelle Schwarzhändler, aber auch Privatverkäufer können von der Meldepflicht betroffen sein.
Welche Daten werden genau gemeldet?
Es muss nicht jede Transaktion gemeldet werden, sondern erst oberhalb von gewissen Freigrenzen. Eine Meldung der Plattform ans Finanzamt ist fällig, wenn ein Nutzer auf einer Plattform innerhalb eines Jahres mindestens 30 Verkäufe getätigt hat oder wenn sein Erlös im Jahr 2000 Euro überschreitet.
Bedeutet: Wenn ein Nutzer auf zwei verschiedenen Plattformen jeweils 29 Verkäufe tätigt, und damit je Plattform weniger als 2000 Euro erlöst, wird weiterhin nichts gemeldet. Umgekehrt reicht schon ein einziger Verkauf für eine Meldung ans Finanzamt aus, wenn der Erlös 2000 Euro übersteigt. Übermitteln müssen die Plattformen Personendaten, Steueridentifikationsnummer, die Zahl der Transaktionen sowie die Höhe der Verkaufserlöse und Gebühren.
Wie soll das praktisch funktionieren?
Praktisch können die Plattformen nur die Verkäufe melden, über die sie auch Kenntnis haben. Das betrifft alle Portale, die eine eigene Bezahlfunktion haben, über die Transaktionen abgewickelt werden. Bei manchen Plattformen ist das der Standardweg. Bei Geschäften auf Ebay Kleinanzeigen nutzen hingegen nur die wenigsten Privatpersonen die eingebaute Bezahlfunktion "Direkt kaufen". "In der Regel erlangen wir keine Kenntnis darüber, ob sich Anbieter und Interessent einig werden, es also tatsächlich zu einem Verkauf kommt", sagt Ebay-Kleinanzeigen-Sprecher Du Bois. Was Kleinanzeigennutzer via Paypal oder bar an der Haustür abwickeln, meldet die Plattform somit auch nicht. Daher seien viele Kleinanzeigen-Nutzer von dem Gesetz auch gar nicht betroffen, sagt Du Bois. "Die Zahl der Anzeigen, die ein Nutzer aufgegeben hat, ist für die Beurteilung jedenfalls unerheblich."
Wird ein Nutzer meldepflichtig, schreibt Ebay Kleinanzeigen ihn mit der Bitte an, die vom Finanzamt geforderten Personendaten mitzuteilen. So verfährt auch die Secondhand-Kleidungsplattform Vinted, wie eine Sprecherin mitteilt: "Verkäufer*innen, die den Schwellenwert erreichen, werden gebeten, ein Formular mit den zusätzlichen Informationen auszufüllen, die durch diese Gesetzgebung erforderlich sind."
Und wer muss jetzt Steuern zahlen?
Nur weil die Plattformen etwas ans Finanzamt melden, heißt das noch nicht, dass darauf Steuern fällig werden. Denn an den Regeln, ab wann man auf seine Erlöse Steuern zahlen muss, ändert sich durch das Transparenzgesetz nichts. Es fällt jetzt nur eben schneller auf, wenn man die Regeln verletzt. Im Grundsatz gilt: Einzelne, unregelmäßige Privatverkäufe sind in aller Regel steuerfrei. Gewerblicher Verkauf mit Gewinnerzielungsabsicht ist dagegen steuerpflichtig.
Leider gibt es viele Fälle, wo die Einstufung nicht offensichtlich ist. Denn hierbei kommt es nicht allein auf die Zahl der Verkäufe und die Höhe der Erlöse an. Wer seinen Keller ausrümpelt und einen Haufen altes Zeug verscherbelt, handelt in der Regel trotzdem privat. Hausrat und ähnliche Dinge des täglichen Gebrauchs können somit auch oberhalb der Meldegrenze von 2000 Euro komplett steuerfrei verkauft werden.
Aber auch private Verkäufer können steuerpflichtig werden, wie die Lohnsteuerhilfe Bayern schreibt: Wer Schmuck oder andere Gegenstände, die nicht dem täglichen Gebrauch zugeordnet werden, binnen eines Jahres weiterverkauft, muss den kompletten Gewinn in der Steuererklärung angeben – allerdings nur, wenn er die Freigrenze von 600 Euro übersteigt.
Ab wann gilt man als gewerblicher Händler?
Auch vermeintlich private Verkäufer können als gewerblich eingestuft werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Da hilft es auch nicht, wenn man in sein Angebot schreibt "Dies ist ein Privatverkauf". Gewerblichkeit erkennt das Finanzamt etwa
- wenn jemand gezielt Produkte ankauft, um sie anschließend mit Gewinnerzielungsabsicht weiterzuverkaufen,
- wenn jemand regelmäßig, dauerhaft oder in erheblichem Maße verkauft,
- wenn jemand viele gleichartige Sachen, Neuware oder selbst hergestellte Artikel verkauft.
Diese Kriterien lassen Graubereiche, die von Finanzämtern und Gerichten unterschiedlich ausgelegt werden. Letztlich bleibt es eine Einzelfallentscheidung.