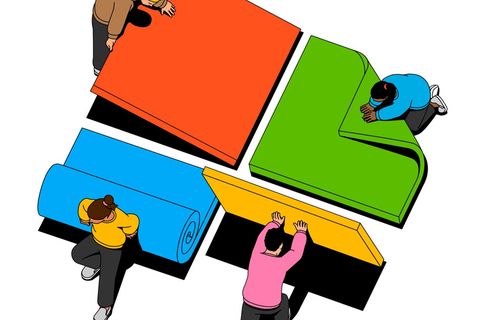Bei Bender, dem Herrenausstatter, ist die gute alte Zeit unterm Dach zu Hause. Das Atelier ist ein lichtdurchfluteter Raum im dritten Stock, mit Panoramablick auf die Stadt. Pfaff-Nähmaschinen stehen darin, schwere Geräte, der stolze Lack verstaubt. Einst wurde hier feines Tuch genäht, von einem Dutzend Schneiderinnen: für die Konfirmanden der erste Anzug, für den Herrn der Blazer, für den Großvater der Smoking.
Im Büro des früheren Chefs hängen Bilder aus den Jahren, als die Einkaufswelt in Siegen noch in Ordnung war. Als die Straßenbahn durch die Oberstadt bimmelte und sich die Passanten an den Schaufenstern drängelten. Als es ungeschriebenes Gesetz war, dass man seinen Anzug bei Bender, den Fotoapparat bei Fuchs, die Bücher bei Nohl und die Brötchen bei Koch besorgte. Als der Konsum noch feste Regeln hatte. Als es den Kaufhof noch gab, den großen, treuen Koloss am Marktplatz, der die Massen anlockte. Ein verlässlicher Partner war er für die vielen kleinen Läden, ein Ernährer, lebenswichtig für das ganze Stadtviertel. Die alte Zeit endete 1998, als das große Kaufhaus schließen musste, zwei Jahre später starb dann auch noch das Bekleidungshaus Hettlage. Seitdem ist die Siegener Oberstadt eine Krisenregion.
Wenn in dieser Woche Gewerkschaften und Management über die Zukunft von 77 der bundesweit 181 Karstadt-Filialen beraten, dann geht es in Wahrheit auch um die Zukunft vieler Stadtquartiere. Eine Verödung der Innenstädte fürchtet der Deutsche Städte- und Gemeindebund bereits, neue Handelskonzepte für die Citylagen fordern Stadtplaner, und mancherorts kamen jetzt die Bürgermeister der betroffenen Kommunen zusammen, um den schlimmsten aller Fälle zu erörtern. Die Oberstadt in Siegen hat das alles schon durchgemacht. Sie ist ein Lehrstück dafür, was mit einem Stadtquartier passieren kann, wenn ein Handelsriese verschwindet und damit ein Großteil der Laufkundschaft - und es keiner so recht wahrhaben will, wenn ein Viertel mit all seinen Einzelhändlern schleichend Bankrott geht.
Bei Hans-Wilhelm Fuchs steht die alte Zeit noch vor der Tür. Abgelaufene Filme liegen in einer Tonne, ein Euro das Stück. Vor einem Jahr hat "Brillen Fuchs" seine Fotoabteilung geschlossen. Jetzt gibt es nur noch Brillen und Kontaktlinsen und einen Beratungsservice speziell für alte Leute. Hans-Wilhelm Fuchs sieht aus wie ein Monarch aus goldenen Zeiten. Das füllige Haar und der Schnauzbart ordentlich gestutzt, die Krawatte britisch gebunden. Schon zweimal wurde Fuchs zum Siegener Einzelhändler des Jahres gewählt, zuletzt mit über 50 Stimmen. "Wir sind hier bekannter als Fielmann", raunt der 65-Jährige und streckt die Wirbelsäule durch.
Wenig später aber sagt er: "Die Zeit des inhabergeführten Einzelhandels ist vorbei." Denn Fuchs weiß, dass vor allem ältere Kunden die Umfrage ausgefüllt haben, Stammkunden. Die seine Beratung schätzen, sein Wissen, sein Plaudern. Er weiß auch, dass er es mit einer neuen Art von Kunden zu tun hat, seit Deutschland im Rabattfieber ist. Und er weiß, dass diese neuen Kunden seinen Laden kaputtgemacht haben, zumindest einen Teil davon.
Es sind die Jungen, die sich beraten lassen und dann nichts kaufen. Die genau wissen wollen, welche Digitalkamera die beste Auflösung hat, um dann im Internet den besten Preis zu ermitteln. Deshalb hat er, kurz bevor er den Laden einem seiner Neffen übergab, zwei seiner langjährigen Mitarbeiter entlassen und mit den Fotosachen Schluss gemacht. "Sonst hätten wir irgendwann den Kunden erklären müssen: Diese Kamera kostet 100 Euro. Wenn Sie auch noch was dazu wissen wollen, 20 Euro mehr." Wer wäre dann noch gekommen? Wo es doch sowieso immer weniger wurden, seit nebenan 100 Meter Schaufensterfront von Kaufhof leer stehen?
"Brillen Fuchs" gibt es seit 74 Jahren in der Siegener Oberstadt. Bender, der Herrenausstatter, war seit 96 Jahren am Platze, bevor die Eigentümer vor zwei Jahren Insolvenz gemeldet haben. Buchhändler Nohl machte nach 55 Jahren Pleite, zuletzt waren nur 40 Kunden am Tag in seinem Laden, sechs Jahre zuvor noch 200. Bäckermeister Koch schloss nach 25 Jahren zwei Läden in der Oberstadt, am Ende verkaufte er gerade noch 50 Gebäckstücke am Tag, Tausende waren es früher. Deichmann ist ausgezogen, die Damen-Boutique, die Drogerie, das Geschäft für Berufsbekleidung. Siegens Oberstadt gleicht einem alternden Gebiss, in dem die besten Füllungen, Brücken und Kronen nicht mehr halten.
Ab und an hängen nun Künstler Bilder in die Schaufenster, hier ein kitschiges Pferd in Schwarz, dort ein Mercedes-SLK in Öl. Mietfreie Spontangalerien, damit die Welt der einsamen Scheiben nicht gar so trostlos aussieht. Im früheren Hettlage-Haus ist ein Rabattladen eingezogen. Es gibt Spülschwämme und Unterhosen. Drei Paar Socken kosten 1,99 Euro. "Textil-Diskont" heißt das Geschäft, in dem man vor lauter großen Werbeschildern die Ware kaum noch sieht. Reduziert hier, Jubelpreise da. Nebenan hat eine Bäckerei eröffnet, selbst die nennt sich "Discounter". Die Einrichtung ist spartanisch. Das Brötchen kostet 14 Cent, bei Bäcker Koch war es zuletzt fast doppelt so teuer.
Weiter unten in der Fußgängerzone hängen Hochzeitskleider zum Schnäppchenpreis und Hosen aus Acryl in einem düsteren Raum; "zehn Euro" steht in Krakelschrift auf gelben Schildern. Fehlen nur noch Spielhöllen und Beate-Uhse-Shops. Aber da hat man Glück in Siegen. Eine Gestaltungssatzung aus den 70er Jahren begrenzt die Zahl einarmiger Banditen und Sexshops im Zentrum der Stadt, die der Geburtsort von Rubens ist. Siegen, 115.000 Einwohner, einst Zentrum der Stahl- und Eisenproduktion, heute laut Landesentwicklungsplan Oberzentrum mit einem Einzugsbereich von 600.000 Menschen. Eine mittelgroße Stadt in ländlichem Gebiet. Die Menschen etwas herzlicher als anderswo, die Stadt etwas hässlicher. Am 16. Dezember 1944 zerstörten Bomben der Alliierten 83 Prozent der Gebäude, und die Architekten des Wiederaufbaus glänzten nicht gerade mit Sinn für das zeitlose Schöne. Den Fluss Sieg verbannten Politiker unter Beton, für mehr Parkplätze. Und ins Schloss quartierten sie den Knast ein, gleich neben das Museum für Gegenwartskunst.
In den 70er Jahren wurden Randorte wie Eiserfeld oder Hüttental eingemeindet. So wirkt Siegen heute wie ein Puzzle, dessen Ecken und Kanten nicht zusammenpassen. Eine Bundesstraße zerteilt die Stadtmitte: im Westen die Unterstadt mit Hauptbahnhof und kleiner Fußgängerzone. Im Osten die Oberstadt, historisches Zentrum am Hang, steilste Fußgängerzone Deutschlands. Im Mittelalter wohnten dort die reichsten Bürger. Heute ist sie Krisengebiet des Einzelhandels.
Siegens Oberstadt könnte auch in Augsburg, Hamburg-Altona oder Remscheid liegen. Deutschlands Fußgängerzonen erleben einen Notstand, der einzigartig ist. Der nicht Folge, sondern eine der Ursachen für die Karstadt-Krise ist. Der schon vorhanden war, als der Unternehmensriese noch auf gute Laune machte. Seit Jahren bluten in deutschen Städten die Traditionsläden aus. Mit ihnen leidet der gesamte Einzelhandel: Der Umsatz wird in diesem Jahr um zwei Milliarden Euro zurückgehen. Voriges Jahr waren es drei Milliarden und davor fünf Milliarden, so der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels. Rund 4.000 Handelsunternehmen haben 2003 Insolvenz angemeldet, knapp 30.000 Geschäfte aufgegeben.
Wer sich bei den Händlern in Siegen umhört, erfährt viel über die Gründe der Krise: Wirtschaftsflaute, Sparwut, gesellschaftliche Verunsicherung. Der Teuro ist schuld, die maßlosen Manager, die Regierung, bin Laden, die Terrorangst, Hartz IV und die Agenda 2010 sowieso. "Kaufzurückhaltung" ist das Unwort des Einzelhandels und "Geiz ist geil" die Hassparole der Fachgeschäfte, deren Erfolgsgeheimnis einst in Qualität und Beratung lag, für die man auch ein bisschen teurer sein durfte. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Lahme Stadtpolitiker, sture Einzelhändler und ein Markt, der sich nur sträubend dem neuen Konsumverhalten anpasst, gehören auch dazu. Trotz Umsatzeinbußen wächst die Ladenfläche in Deutschland weiter - allein um zwei Millionen Quadratmeter in diesem Jahr. Für jeden Einwohner stehen damit 1,38 Quadratmeter Konsumfläche bereit, da ist Deutschland Spitze in Europa. Der Kuchen wächst und wächst, obwohl die Kunden immer weniger davon essen wollen. Seit 1993 sinkt der Umsatz, der pro Quadratmeter erwirtschaftet wird.
Auch in Siegen ist die Ladenfläche gewachsen: Ende der 90er Jahre entstand in der Unterstadt ein monströser Bau. Die Hamburger ECE-Gruppe baute die "City-Galerie", eine dreigeschossige Ladenzeile. Mit einem Konzept, das überall in Deutschland funktioniert: einheitliche Öffnungszeiten, ein straffes Management, ein Dach über der Galerie und warme Luft darin. Gemeinsame Werbung, ein abgestimmter Branchenmix, starke Ketten mit solidem Umsatz. Douglas neben Saturn. Hugendubel neben Esprit. Im März Veilchen zum Tag des Frühlings, im Sommer Schauspieler im Federschmuck zu den Karl-May-Tagen. Der Stadtrat hatte damals zugestimmt. Er wusste zwar, dass er der Oberstadt damit keinen Ge-fallen tat, doch die Devise lautete: Wenn wir das Einkaufszentrum nicht bekommen, bekommt es ein anderer. Also bekam es Siegen.
Die Kundenströme aus dem Umland sind seitdem tatsächlich wieder angeschwollen. Nur nicht in der Oberstadt. Viel wurde geredet, von einem neuen Konzept für die alte Innenstadt, von einem großen Umbau, von einem Aufzug, der die neuen Kunden von der Unterstadt in die Oberstadt auf den Hügel bringen sollte. Am Ende fehlte wie immer das Geld. Das alte Zentrum liegt seitdem am Boden. Die konsumfaulen Verbraucher versetzen ihm die letzten Tritte, und die Einzelhändler haben erst spät gemerkt, dass man sich dagegen auch wehren muss.
"Die Oberstadt ist nicht mehr zu retten", sagt Dieter Speier, der zwei Jahre lang einen Laden für schottische Spezialitäten führte. "Und zu einem großen Teil sind die Einzelhändler selbst dran schuld." Wer flaniert schon in einem Viertel, in dem manche Geschäfte nur dreimal in der Woche geöffnet haben, andere werktags erst ab 15 Uhr? Wo Verkäuferinnen um 18 Uhr die Ständer reinräumen und ihre Mienen sagen, dass der Service nun Feierabend hat. Wer kauft in Läden, in denen die Unterhosen auf dem Werbeschild Schlüpfer heißen, die Regale seit 20 Jahren nicht erneuert wurden? Wie soll Kundenbindung funktionieren, wenn an einem verkaufsoffenen Feiertag nur die Hälfte der Händler mitmacht? Dieter Speier vermisste in Siegen, "dass alle gemeinsam mit anpacken."
Immerhin gibt es in Siegen seit gut zwei Jahren Menschen, die sich hauptberuflich um die Krise kümmern, eine "Strukturoffensive" ins Leben gerufen haben und optimistisch in die Zukunft blicken. Das Zentrum der guten Laune liegt im ersten Stock des Rathauses, Zimmer B 218. Manuela Kase ist Mitarbeiterin der Gesellschaft für Stadtmarketing, einer Dachorganisation der lokalen Wirtschaft.
"Der erste Schritt zum Erfolg ist, dass man den Sinn eines professionellen Marketings für ein Stadtviertel erkannt hat", sagt Manuela Kase. Sie kramt einen Flyer hervor. "Sehen Sie, wir haben schon ein bisschen Berlin in Siegen." Es ist eine Werbung der "Anziehbar", eines kleinen Ladens in einer Seitenstraße, in dem ein 34-jähriger Student und eine 21-jährige Designerin Kleidung verkaufen, zwischen Fernsehgeräten aus den 70er Jahren, Barbiepuppen und Parabolspiegeln im Schaufenster. Ein Wohnzimmer mit Einkaufsmöglichkeit, in dem geraucht werden darf. Dass solch junge Läden öffnen, liegt auch an den Mieten: Die sind in der Oberstadt in den vergangenen zehn Jahren um das Zwei- bis Fünffache gefallen, heute ist der Quadratmeter für fünf bis 25 Euro zu haben. Die Hauseigentümer verzichten auf die üblichen Zehnjahresverträge, weil sie froh sind, für drei Monate ein paar Euro einzunehmen. Der verwaiste Kaufhof kostet nur noch zwei Millionen Euro, der Preis lag mal bei 24 Millionen Mark. "Unsere Chance", sagt Manuela Kase. "Jetzt trauen sich die Existenzgründer, deren Geldbeutel bislang zu dünn war." Doch wer kauft gleich einen Kaufhof?
Manuela Kases Kollege hat sich seine Vision ins Büro gehängt. Frank Manfrahs hat Urlaubsfotos vom Gardasee mitgebracht und auf einen handgemalten Straßenplan geklebt: cremefarbene Geschäftsfassaden, Terrakottafliesen, verwinkelte Gassen - so könnte die Oberstadt mal aussehen. Gleich daneben hängen Ideenzettel für Aktionen: Flohmarkt, ein Beachvolleyball-Festival im Sommer und eine künstliche Skipiste im Winter. Manfrahs ist Geschäftsführer der neu gegründeten Immobilien- und Standortgemeinschaft in Siegen, eines Zusammenschlusses von 50 Hauseigentümern und Gewerbetreibenden, die ihr Quartier nach dem Muster der amerikanischen "Business Improvement Districts" sanieren wollen (siehe "Mehr zum Thema").
Der 35-Jährige hat Betriebswirtschaft studiert und weiß, "dass eine solche Strukturkrise nicht von heute auf morgen zu lösen ist, sondern nur in kleinen Schritten." Er kennt jeden der 150 Immobilienbesitzer in der Oberstadt, bei einigen sitzt er regelmäßig zu Hause auf dem Sofa. Die ersten Erfolge der Stadtplaner sind schon erkennbar: Zehn Prozent mehr Kunden besuchen die Oberstadt als im Jahr zuvor. In der Alten Poststraße, in der jeder fünfte Laden leer stand, gibt es kein verwaistes Geschäft mehr, außer dem Chinesen, der gerade "vorübergehend geschlossen" hat. Im Hettlage-Haus hat sich ein Café einquartiert, in den einstigen Kaufhof sollen irgendwann einmal Stadtbibliothek, Archiv und Volkshochschule einziehen. Selbst das Modehaus Bender ist auferstanden: Eine Tochter der Familie hat das Gebäude bei einer Zwangsversteigerung günstig erstanden, jetzt werden dort wieder Anzüge und Pullover verkauft.
Walter Schwerdfeger ist Optimist, und das liegt mit daran, dass sein "Teppich-Forum" trotz Krise den Umsatz steigert. Der 59-Jährige sagt: "Es geht vieles, wenn man nur will." Schwerdfeger wollte zum Beispiel, dass Siegen wieder ein schönes Theater bekommt. Er hat viele wohlhabende Siegener überzeugt und Unterschriften gesammelt, jetzt erhält die Stadt ein schönes Theater, dessen Betrieb privat finanziert wird. Zum Gespräch erscheint Schwerdfeger, der Ehrenvorsitzende des Siegener Stadtmarketings ist, mit einem Papier, auf dem er einen Satz dick unterstrichen hat: "Krise ist Chance." Er hat sich gut vorbereitet: Die Menschen suchten neben Einkaufszentren, Aldi und E-Commerce nach wie vor die "lokale Identität". Einkaufen in der Innenstadt müsse wieder zum Erlebnis werden. Disziplin brauche man dafür, gleiche Öffnungszeiten, gemeinsame Werbung. Absprachen im Warenangebot. Abgestimmte Schaufenster. Mehr Beleuchtung. Wieder eine Straßenbahn. Oder was Lustigeres. "Wir können die Einzelhändler dazu nicht zwingen", sagt Schwerdfeger. "Aber das große Leiden zwingt sie, gemeinsam zu denken."
Das Referat dauert drei Minuten, dann legt Schwerdfeger das Papier zur Seite und putzt die Lesebrille. Natürlich, so ein Wandel sei eine Sache von Jahren. Klar, die Siegener sind Dickköpfe. Für manchen Laden sei die Zeit einfach vorüber, auch wenn man das nicht laut sagen dürfe. Und lokale Politiker brächten oft auch nur Unglück: Sie begrüßten es, dass nun ein Obi geplant ist, ein Gartencenter, eine neue Shopping-Mall namens Sieg-Carree und dass es für 14 Industriebrachen in der Stadt Anfragen von Discountern gebe - das seien doch alles Todesurteile für die Oberstadt. Und wie es dort mit Karstadt weitergeht, "weiß in Wahrheit doch auch niemand". Es werde verdammt schwer, sagt Schwerdfeger. Denn die gute alte Zeit ist ein für allemal vorbei. Die gute alte Zeit, als für die Händler Siegen noch gewinnen hieß.