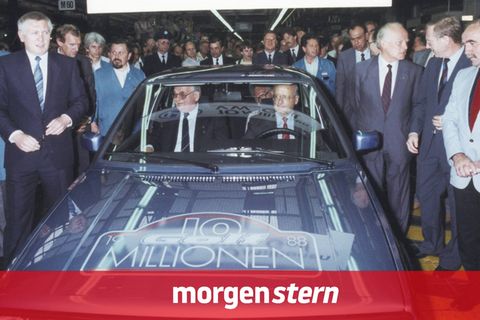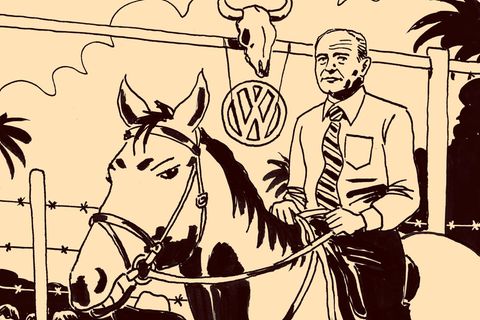Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hört sich zunächst hart und konsequent an: Das VW-Gesetz, das seit 1960 in dem Konzern staatlichen Einfluss zementiert, verstößt in seinen Kernpunkten gegen EU-Recht. Also weg damit! In der Marktwirtschaft gilt: Wer sein Geld in eine Aktiengesellschaft steckt, soll auch entsprechend seiner Investitionen mitentscheiden dürfen. Dieses Signal sendet der Gerichtshof mit seinem Urteil aus. Das Unternehmen Porsche, das bei VW auf dem Weg zur milliardenschweren Mehrheitsübernahme ist, vernimmt solche Töne gern.
Niedersachsen bleibt mächtig
Doch wer glaubte, die traditionelle Einflussnahme des Landes Niedersachsen auf VW gehöre damit automatisch der Vergangenheit an, der irrt gewaltig. Das Land wird bei Volkswagen weiter mitregieren - auch wenn das VW-Gesetz geändert wird.
Zunächst sagt das Gerichtsurteil nichts darüber, dass sich der Staat oder das Land Niedersachsen aus dem Unternehmen gefälligst zurückzuziehen haben. Der Bund tat dies zwar bereits aus freien Stücken, aber Niedersachsen hält gut 20 Prozent an VW - und das wird aller Voraussicht nach noch lange so bleiben.
Konzernsatzung bleibt noch unverändert
Der 20-Prozent-Anteil reicht dem Land nach heutiger Lage, um bei grundlegenden Konzernentscheidungen das Zünglein an der Waage zu spielen. Zwar wendet sich der Gerichtshof in seinem Urteil unter anderem gegen diese abgesenkte Sperrminorität (als Schwelle üblich ist ein Aktienanteil von 25 Prozent). Das heißt aber nicht, dass die Volkswagenaktionäre auch die entsprechenden Bestimmungen in der Satzung des Unternehmens ändern müssen.
Die Konzernsatzung bildet das VW-Gesetz im Großen und Ganzen noch einmal ab. Das Urteil richtet sich nur gegen den Gesetzgeber Bundesrepublik und sein VW-Gesetz, nicht etwa gegen die Aktionäre bei Volkswagen und ihre Satzung. Denen bleibt es weiter unbenommen, Sperrminoritäten festzuschreiben, die vom Mainstream abweichen. Ob sie das wollen, muss eine Hauptversammlung zeigen. Gut möglich, dass sich das Land und der Porsche-Patriach Ferdinand Piech in Hinterzimmer-Gesprächen längst auf einen Modus verständigt haben, der Niedersachsen mit im Boot hält.
Pakt zwischen Politik und Patriarch
Zur Erinnerung: Ende 2006, im Strudel der VW-Affäre um Prostituierte und Betriebsratsbegünstigungen, war der Riss tief zwischen dem niedersächsischen Ministerpräsident Christian Wulff und dem VW-Aufsichtsrat Piech. Wulff agierte offen gegen eine Wiederwahl Piechs an die Spitze des Kontrollgremiums. Wenige Wochen später trafen sich die beiden wiederholt in vertraulichen Zirkeln. Und auch einen Ausflug in die Betriebshallen bei VW unternahm Wulff. Dabei muss der CDU-Politiker, der im Januar 2008 vor Wahlen steht, instinktiv gefühlt haben, dass man gegen die Stimmung zehntausender VW-Arbeiter in der ansonsten strukturschwachen Region nicht gewinnen kann.
Nach allem, was man hören konnte, kam es zu einer Art Pakt zwischen Politik und Patriarch: Wulff lässt nun Piech bei VW gewähren. Dafür verschont der Alte den CDU-Mann vor unangenehmen Überraschungen an den niedersächsischen VW-Standorten. Und auch eine weit reichende Zusage in Sachen Aufsichtsrat habe Wulff dem Porsche-Erben abgerungen: Wie bisher soll das Land zwei Aufsichtsratsmandate stellen. Das sind genau jene Verhältnisse, wie sie heute in dem umstrittenen VW-Gesetz und der Satzung festgeschrieben sind.
Mitbestimmungsrecht völlig unberührt
Eine VW-Besonderheit hat der Gerichtshof übrigens erst gar nicht berührt: die ausgedehnten Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer. Standortverlegungen etwa sind ohne die Zustimmung des Arbeitnehmerflügels im Aufsichtsrat nicht zu machen. Und wenn sich die Belegschaft wie einst zu SPD-Zeiten in Niedersachsen mit den beiden Aufsichtsräten des Landes verbündet, dann besitzen sie gemeinsam die Kontrolle über Volkswagen. Produktivität und Kostensenkung zählt da zwar, mindestens genauso wichtig ist aber auch der Arbeitsplatzerhalt. Auch nach dem so entschieden klingenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird aus VW kein gewöhnliches Unternehmen.