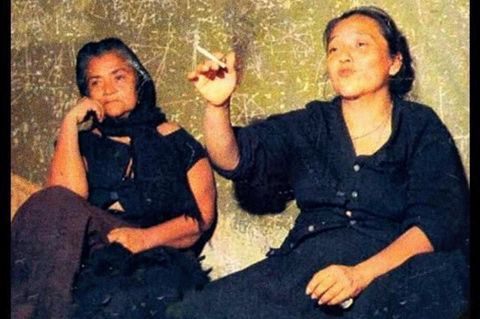In Moskau gibt es keinen Zweifel daran, dass der 41-Jährige in dieser Woche als Betrüger und Geldwäscher zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt werden wird.
Wie kaum ein anderer verkörpert Chodorkowski die Entwicklung der russischen Wirtschaft. Als Ende der achtziger Jahre der Komsomol, der Jugendverband der Kommunistischen Partei, die ersten Experimente mit dem Markt veranstaltete, war der junge Michail an vorderster Stelle mit dabei. Ob Handel mit Gorbatschow-Matrjoschka-Puppen, Computern oder französischem Cognac: Chodorkowski hatte Erfolg. Und zwar so viel, dass der studierte Chemiker mit Freunden und einer randvollen Kasse 1988 die Menatep-Gruppe gründete.
Diese Bank war 1995 zuständig für die Registrierung der Gebote im Rahmen der Privatisierung der Yukos-Stammbetriebe. Es gelang der Gruppe, sich für nur 300 Millionen Dollar ein Kontrollpaket zu sichern. Behilflich war, dass Chodorkowski kurzzeitig als Vize- Energieminister fungiert hatte und somit über beste Verbindungen auf allen Ebenen verfügte.
Die dank der Ölexporte sprudelnden Dollar investierte Chodorkowski in moderne Fördertechnik, um international wettbewerbsfähig zu werden. Zudem verschrieb er seiner Firma eine offene Unternehmenspolitik und sich ein neues Image: Schnauzbart und übergroße Brille kamen weg, stattdessen trat Chodorkowski glatt rasiert und im schwarzen Rollkragenpulli auf. Der Multi-Milliardär und Yukos avancierten zu den Lieblingen der Investoren. Der Börsenwert stieg zeitweise auf über 30 Milliarden Dollar.
"Geld interessiert mich nicht", soll Chodorkowski einmal gesagt haben. Über seine finanzstarke Stiftung "Offenes Russland" wollte er sein Anliegen voranbringen, die Zivilgesellschaft in seiner Heimat zu fördern. Mit seinem politisches Engagement, das die Finanzierung von Oppositionsparteien einschloss, verstieß er aber gegen ein ungeschriebenes Gesetz des Kremls: Immunität im Gegenzug dafür, dass sich die Oligarchen aus der Politik heraushalten.
Alexandra Stark/DPA