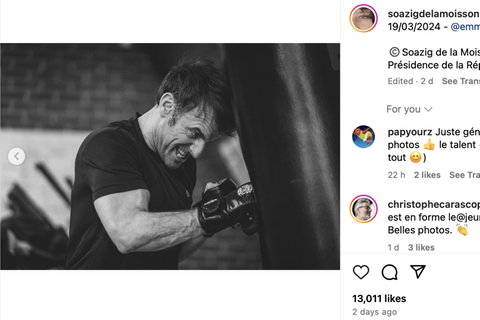Der deutschen Autoindustrie droht der Verlust eines ihrer wichtigsten Verkaufsargumente. Das Gütesiegel »Made in Germany« gilt vielen Autofahrern und Technikern nicht mehr als Inbegriff für Qualitätsarbeit. Mängel in Serie setzen den guten Ruf der deutschen Autos aufs Spiel.
Produktionsfehler häufen sich
Etliche Neuwagenkäufer berichten empört über ihre Erfahrungen: Gerade 12,5 Kilometer schaffte die 28 Jahre alte Angestellte aus Frankfurt mit ihrem nagelneuen Mittelklassewagen - dann legte ein gerissener Keilriemen das Fahrzeug lahm. Ein 22 Jahre alte Krankenschwester bekam ihren Kleinwagen schon mit undichtem Lenkgetriebe ausgeliefert, ein Rentner beklagt sich über einen bereits nach wenigen Monaten durchgerosteten Auspuff. Dass dies keine Einzelfälle sind, zeigen die Leserbriefspalten der Autozeitschriften, in denen die Beschwerden über Mängel an neuen Autos nicht abreißen.
Vertrauen in Qualität sinkt
Selbst deutschen Herstellern traditionell wohl gesonnene heimische Fachblätter kommen an dem Qualitätsthema nicht mehr vorbei: »Auto Bild« fragte angesichts polternder Achsen und rostiger Bleche: »Was ist bloß mit unseren Autos los?«. »auto motor und sport« stellt nach einer peniblen Auflistung der häufigsten Reklamationen an deutschen Autos fest: »Das Vertrauen in die Qualitätsbeteuerungen schwindet. Fatalerweise betrifft dies vor allem jene Marken, die sich das Prädikat Premium auf die Fahne geschrieben haben.«
Japaner führen Pannenstatistik an
Beim Automobilclub ADAC weiß man schon lange, dass nicht alles Gold ist, was an deutschen Autos glänzt. Die jährliche Pannenstatistik sieht mit eindrucksvoller Regelmäßigkeit japanische Wagen auf den Spitzenplätzen der verschiedenen Größenklassen - meist mit deutlichem Abstand vor den einheimischen Konkurrenten. Rückrufaktionen, die vor einigen Jahren noch in jedem Einzelfall Aufsehen erregten, sind mittlerweile so häufig geworden, dass sie kaum noch Beachtung finden. Von 58 auf 94 im Jahr sind sie innerhalb der vergangenen vier Jahre gestiegen, wie aus dem Kraftfahrtbundesamt zu hören ist. In den Fachblättern wie der »ADAC-Motorwelt« erscheinen sie meist nur noch als Randnotiz.
Häufige Rückrufaktionen
An den Rückrufaktionen seit Ende des vergangenen Jahres waren alle größeren deutschen Hersteller beteiligt - die Marke Mercedes sogar gleich zwei Mal. Dabei müssen Rückrufe nur eingeleitet werden, wenn die Probleme die Fahrsicherheit beeinträchtigen, also vorwiegend Bremsen, Fahrwerk, Lenkung oder Ähnliches betreffen. Beim »normalen« Ärger wie Motorschäden, Rostbefall oder Elektronik-Defekte erfährt der Autofahrer selten, ob er Opfer eines Serien-Fehlers geworden ist oder ob ihn ein Ausnahmefall erwischt hat.
Vertrauen in Marken sinken
Dass deutsche Autos viele Schwächen haben, spricht sich auch im Ausland herum. Nachdem die Schweden mit ihrem Elchtest die Mercedes A-Klasse schon ins Schleudern gebracht haben, fährt jetzt der norwegische Automobilverband den deutschen Firmen an den Karren. Die sprichwörtlich gewordene deutsche Wertarbeit gebe es zumindest auf dem Automobilsektor immer seltener, schreibt der Autofachmann Paul Anderson, der einer offiziellen Beschwerdestelle für Autokäufer angehört. Der VW Passat, die Mercedes-Modelle Vito und A-Klasse sowie Audi-Fahrzeuge sind besonders häufig von Beschwerden betroffen.
Viele Schwächen bei deutschen Autos
Die Tester von »auto motor und sport« kennen diese Probleme dutzendweise: Sie reichen von Getriebe- und Motorschäden bei Audi über Wassereintritt und gefährdete Benzinleitungen bei Porsche bis zu Motordefekten und Klappergeräuschen bei BMW sowie fehlerhaften Bremsen, Getrieben und Lenkungen bei Mercedes. Bei Opel führten zuletzt Sitzbefestigungen und bei Ford die Airbag-Steuerung zu Rückruf-Aktionen.
Zeitdruck bei der Konstruktion
Eine der wesentlichen Ursachen für die schlechte Qualität ist nach Ansicht des Leiters der ADAC-Verkehrsabteilung, Götz Weich, der Zeitdruck bei der Konstruktion der Autos und ihrer Bauteile. »Das Entscheidende sind die kurzen Entwicklungszeiten«, sagt Weich, der auch Mängel in der Praxiserprobung vermutet. »Wird der Kunde zum Testfahrer, der das Auto zur Serienreife reklamieren soll?«, fragte der Automobilclub nach seinem jüngsten Praxistest mit 8.000 Fahrern von Kleinwagen. Hier hatten in der Rubrik Reparaturhäufigkeit ausnahmslos deutsche Fahrzeuge die hinteren Plätze belegt.
Lopez-Effekt wirkt nach
Automanager gestehen auch Spätfolgen des so genannten Lopez- Effektes ein. Der als Kostensenker erst gefeierte und dann verrufene frühere Einkaufschef von Opel und VW hat die Zulieferer der Automobilindustrie dermaßen geknebelt, dass sie unter dem Zwang zur Billiglieferung die Qualität vernachlässigten. »Der Lopez-Effekt schleicht sich durch die Autoindustrie«, sagt ein Produktionsfachmann, der noch einen anderen Grund für die Mängel kennt: Manchen Firmen hatten eine Zeit lang die reale Erprobung vernachlässigt und sich bei der Entwicklung zu sehr auf Computersimulationen verlassen. »Die japanischen Firmen waren dabei eher zurückhaltend.«
Wilfried Willutzki