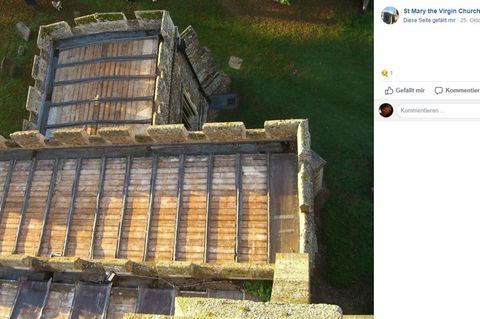Eckhard Seemann steht am Rand seines Feldes und zieht mit dem Finger eine Linie zum Horizont. "Hier soll das Stromkabel verlaufen", sagt der Landwirt. Unterirdisch, quer durch den Acker. "Ich habe den Boden von meinen Eltern im Vertrauen übertragen bekommen, und ich liebe ihn." Bald könnten Bagger anrollen und eine tiefe Furche hindurchziehen.
Bauer Seemann aus Bredenbeck bei Hannover hat Angst. Nach den Plänen des Stromnetzbetreibers Tennet würde die neue Höchstspannungsleitung "Suedlink", die Windstrom vom Norden in den Süden Deutschlands liefern soll, durch fünf seiner Äcker führen. Die armdicken 320.000-Volt-Kabel können circa 55 Grad heiß werden. Trocknet der Boden dadurch aus? Wird der natürliche Wasserhaushalt gestört? Sinken die Erträge bei Weizen, Mais, Zuckerrüben oder Raps? Seemann sagt: "Wir werden uns wehren." Darin ist er sich mit den anderen Bauern im Dorf einig – mehr noch, bundesweit stehen derzeit Landwirte gegen die unterirdischen Stromautobahnen auf. Mit diesem Widerstand hatte kaum jemand gerechnet.
Erfolgreicher Bürgerprotest gegen oberirdische Kabel
Ursprünglich sollten die neuen Superleitungen, die als wesentliche Voraussetzung für die Energiewende gelten, oberirdisch verlaufen. Jahrelang hatten sich entlang der geplanten Trassen jedoch Bürgerinitiativen dagegen gebildet, sie nannten sich "Ab in die Erde" oder "Pro Erdkabel NRW", und ihre Mitglieder bangten um Gesundheit und freien Blick aus dem Wohnzimmerfenster. Am Ende wetterte auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer gegen die "Monstertrassen".
Im vergangenen Dezember beschloss dann der Bundestag, die noch rund 1150 Kilometer fehlenden Höchstspannungsleitungen weitestgehend zu verbuddeln. Um die Menschen zu beruhigen und mit dem Netzausbau zu beginnen, akzeptierte man Mehrkosten in Milliardenhöhe. Nun droht sich der Ausbau weiter zu verzögern – wegen der Bedenken der Bauern. Achim Hübner vom Landvolk Göttingen sagt: "Wenn die Leitung quer durch den Acker geht, ist er nur noch schwer zu bewirtschaften." Hubertus Schmitte, Justiziar beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, warnt: "Es gibt noch keine Erfahrungen mit Folgeschäden." Und Georg Wimmer, stellvertretender Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbands, fordert: "Die Erdverkabelung muss die Ausnahme bleiben."
Tatsächlich ist der Eingriff in die Natur nicht trivial – das zeigt sich an der Trasse Wesel-Meppen, wo der Netzbetreiber Amprion den ersten Erdkabelversuch mit Drehstrom überhaupt durchführt. Die Bagger schlagen bis zu zwei Meter tiefe Furchen in den Boden. Während der Bauphase verdichten sie ein 41,5 Meter breites Areal des Feldes – breiter als eine sechsspurige Autobahn. Am Ende dürfen die Landwirte einen bis zu 22 Meter breiten Schutzstreifen nur noch eingeschränkt nutzen, weil die Trasse im Schadensfall frei zugänglich sein muss. Wie die Leitungen das Wachstum der Pflanzen auf Dauer beeinflussen, ist noch weitgehend unklar.
"Bei der Planung versagt"
Schon bei der Planung der Trassen hätten Politik und Netzbetreiber versagt, erklärt Rainer Horn, Professor für Bodenkunde an der Universität Kiel. "Einfach einen breiten Strich von Nord nach Süd ziehen reicht nicht aus." Zunächst müsse der Boden untersucht werden, ob er geeignet sei für Höchstspannungskabel, dann erst könne der Trassenverlauf geplant werden. In der Realität laufe es genau umgekehrt, sagt Horn. Und beim Bau müsste eigentlich neben jedem Bagger ein Experte wachen: "Nur wenn die Arbeiten kontinuierlich und mit bodenkundlichem Sachverstand begleitet werden, sind langfristig keine Schäden zu erwarten."
Nun geht es, wie so oft bei der Energiewende, ums Geld. Für jeden Meter Kabel müssen die Netzbetreiber mit den Bauern eine Abfindung aushandeln. Das wird den Preis für den Netzausbau weiter in die Höhe treiben – auf Kosten der Stromkunden. Beim Pilotprojekt an der Strecke Wesel-Meppen bekommen die Landwirte rund 120 Euro pro Leitungsmeter. Mögliche Folgeschäden, die in den nächsten zehn Jahren auftauchen, werden extra abgerechnet. An diesem Modell orientieren sich die Bauern in anderen Regionen. Eckhard Seemann sitzt am Küchentisch. Der Wandkalender über ihm zeigt als Novemberbild einen Haufen Zuckerrüben. Er sagt: "Ich will keine Kapitalabfindung, lieber eine Überlandleitung. Die wäre für uns Landwirte das kleinere Übel."