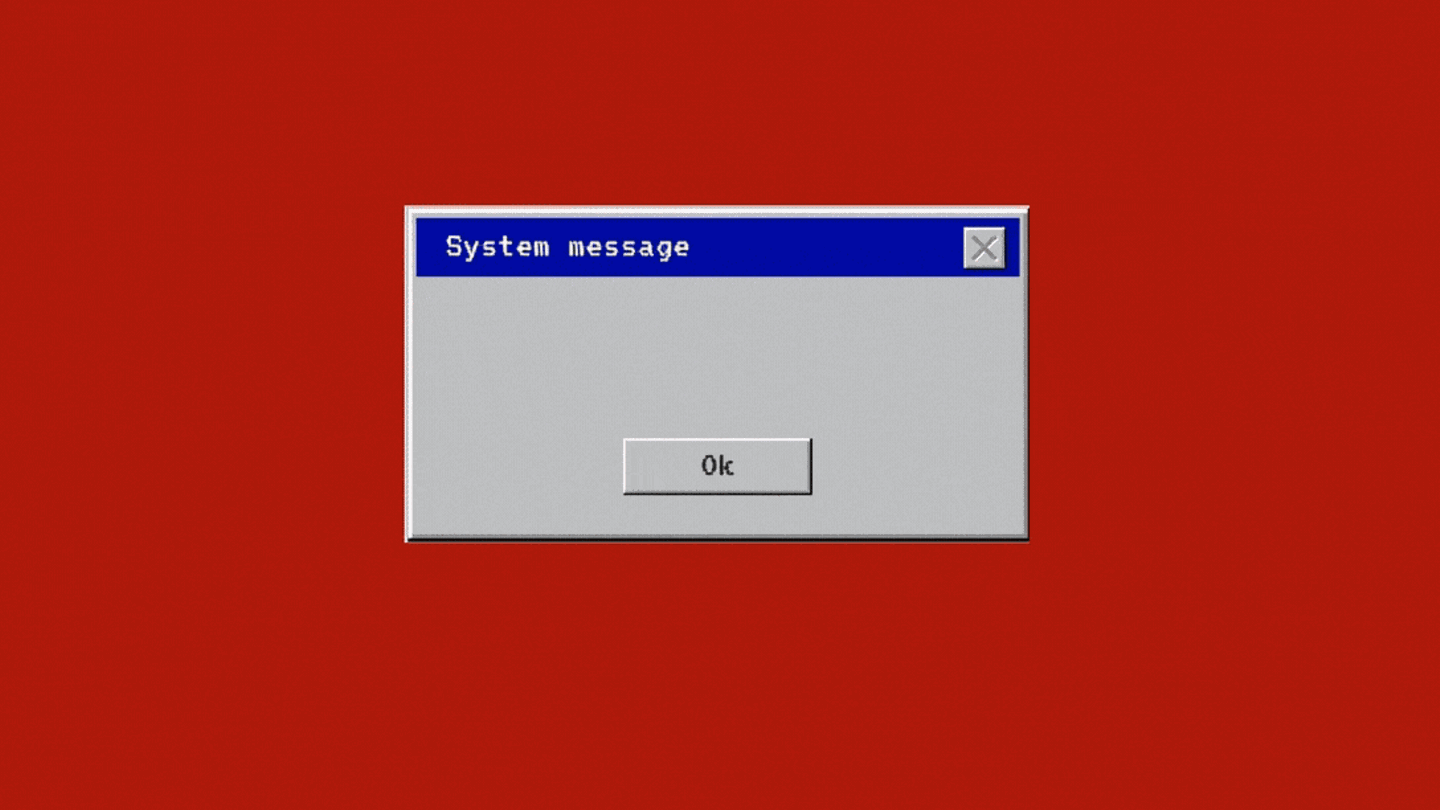Wer in einem "modernen" Unternehmen je versucht hat, eine Spesenabrechnung einzureichen, hasst diesen Horror: Man ackert sich durch kryptische Menüs wie auf Gepäckmarsch, man ringt mit Formularen, die "gestaltet" sind, als wären sie von einem Archäologenteam exhumiert worden. Und wartet darauf, dass die Fehlermeldung "Objekt nicht gefunden" zuschlägt. Wo coole Apps in der Realwelt um unsere Gunst buhlen, wirkt die Unternehmenssoftware drinnen wie ein algorithmischer Stromberg – destruktiv, gehässig und entschieden effizienzfeindlich.
Manche der Systeme aus dem Cringe-Kosmos des Digitalzeitalters haben einen derart zweifelhaften Ruf, dass sie in Mitarbeiterkreisen beinahe legendär sind. Concur zum Beispiel, das Spesenportal, das ganze Firmenflure in seufzende Selbsthilfegruppen verwandelt. Wer je versucht hat, dort einen Beleg hochzuladen, kennt das Gefühl: Der Weg dorthin wurde so tückisch verschachtelt, als hätte eine geheime Arbeitsgruppe für Stresspsychologie inkognito am Interface mitgeschrieben – und zwar gleich nach Abschluss eines mehrjährigen Projekts in der Sadismus-Forschung. Um herauszufinden, wie viel Geduld ein Mensch wirklich aufbringen kann.
Warum ist das so? Warum ist Software, die Millionen Menschen täglich zwangsnutzen müssen, so quälend gebaut? Die Antwort wurzelt in einer ernüchternden Wahrheit: Interne Nutzer sind keine Kunden. Wir können uns unser Tool nicht aussuchen, haben keinen App-Store, keine Alternative, es gibt keine Abstimmung mit den Füßen. Wenn das Unternehmen sagt: "Das ist unser Portal", dann ist das "unser" Portal. Punkt. Wo es keinen Wettbewerb gibt, entsteht auch kein Druck, besser zu werden. Die Software muss nicht geliebt werden, wie echte Software. Die Knirsch- und Quietschmaschine muss bloß vordergründig funktionieren – etwa so wie eine realsozialistische Volkswirtschaft.
Im digitalen Museum der Prozesse
Obendrauf kommt eine zweite Schieflage: Interne Software wird nicht für Menschen gemacht, sondern für Prozesse. Für Dokumentationspflichten, Regelkonformität, Revisionssicherheit. Sie sieht aus wie eine Nutzeroberfläche, dient aber zuallererst der Beruhigung jener Abteilungen, die auf kleiner Flamme im ewigen Zweifel an der Redlichkeit der Menschheit köcheln, aber nicht denjenigen, die jeden Tag damit arbeiten. Ob ein Formular in drei Minuten oder dreißig auszufüllen ist, spielt in dieser Logik kaum eine Rolle. Hauptsache, jeder Schritt ist sauber protokolliert. Dass es dabei zu millionenfacher Arbeitszeitvernichtung kommt, wird stillschweigend eingepreist – den Preis zahlen die Produktiven.
Besonders sichtbar wird das im Einflussfeld der dominanten Backend-Giganten: dort, wo die Tentakel von SAP, Oracle und all ihren Verwandten die Arbeitswelt durchschnüren. Unter ihren harmlosen Oberflächen in Waschbeton-Ästhetik erstarren Systeme, die über Jahrzehnte angewachsen sind – ein verzweigtes Wurzelwerk aus Tabellen, Regeln und Abhängigkeiten. Das, was wir sehen, ist die dünn verklinkerte Sperrholzfassade eines gigantischen Maschinenraums. Jede noch so gut gemeinte Oberfläche muss gegen die schwarzlochstarke Gravitation der 20.-Jahrhundert-Architektur ankämpfen. Kein Wunder also, dass sich manche HR- oder Finanzportale so anfühlen, als hätte man einen Tabletbildschirm mit Tesafilm über ein Industrie-Schaltpult mit faustdicken Drehschaltern geklebt.
Erschwerend kommt hinzu, dass in zahllosen Unternehmen niemand mit nennenswertem Einfluss wirklich für das Nutzererlebnis verantwortlich ist. Die HR definiert Prozesse, die IT implementiert sie, Compliance prüft, der Einkauf drückt die Preise, externe Berater droppen Standardmodule. Jede dieser Gruppen verfolgt irgendwie irgendwelche legitimen Ziele – für sich genommen. Nur das Bedienerlebnis taucht in kaum einer dieser Bedeutsamkeitsblasen auf. So entsteht Software, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllt (und oft ein paar imaginierte noch dazu), aber kaum eine menschliche.
Die langen Lebenszyklen tun ihr Übriges. Privat genutzte Apps werden seit Jahren alle paar Wochen überarbeitet – finden wir einen Bug, dürfen wir sicher sein, dass er wie von Geisterhand alsbald verschwindet. Dagegen verharren interne Systeme oft jahrelang auf dem gleichen Stand. Jede Anpassung ist teuer, riskant und muss durch Gremien, Tests und Audits. So sedimentiert die Software, Schicht um Schicht, bis sie nicht mehr technologisch wirkt – sondern geologisch.
Ein Hoffnungsschimmer für Unternehmenssoftware
Und doch: Es tut sich ein bisschen was. Moderne Portale setzen in nicht mehr ganz geologischen Zeitmaßen auf klarere Oberflächen, mobile Nutzung, einfachere Prozesse. Manch eines bekommt nach und nach Module, die aussehen, als wären sie tatsächlich für tendenziell menschenähnliche Gegenüber entworfen worden. Unternehmen begreifen langsam, dass schlechte Software nicht nur frustriert, sondern Produktivität zerstört und Talente vergrault. UX-Designer werden eingestellt, "Employee Experience" wird hier und da zum ernst gemeinten Begriff.
Diese Entwicklung kommt spät. Sie ist zäh, und sie wird nicht über Nacht alles besser machen. Aber sie ist da. Vielleicht werden wir eines Tages zurückblicken und sagen: Diese elenden Fossilien, diese unzugänglichen Oberflächen – das war der Preis der Übergangszeit, so wie die fußbetriebene Nähmaschine und das unsynchronisierte Getriebe mit Zwischengas. Irgendwie ein Preis dafür, dass Unternehmen erst lernen mussten, digitale Werkzeuge nicht nur für Kundinnen und Kunden wirklich zu gestalten, sondern auch für die eigenen Leute.
Bis dahin aber bleibt landauf, landab ein ebenso leises wie nachhaltiges Hoffnungsglimmen: Es könnte eines Tages möglich sein, eine Bahnfahrt abzurechnen, ohne seine Lebensfreude zu verlieren. Irgendwann, in einem Zeitalter, in dem die Züge pünktlich kommen. Es könnte möglich sein, dass digitale Werkzeuge nicht mehr feindselig und strukturarrogant wirken. Nicht bald, aber irgendwann. Aber eigentlich haben wir jetzt schon lange genug gelitten.