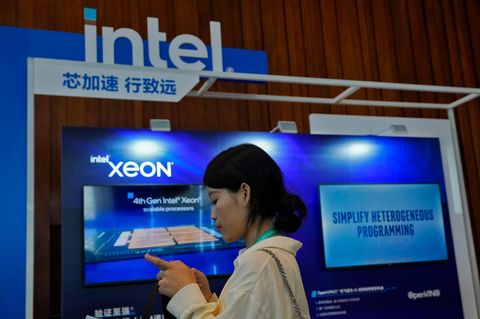Man muss schon sehr genau hinsehen, um in dem Artikel, der im April 1965 im "Electronics"-Magazin erschien, die berühmteste Gesetzmäßigkeit der Computerwelt zu entdecken: "Moore's Law" - die Vorhersage von Gordon Moore, Mitgründer des Chipherstellers Intel, dass sich die Leistung von Elektronenhirnen Jahr für Jahr verdoppeln würde. So wird Moores Grundgesetz fürs Digitalzeitalter, das seit nunmehr 40 Jahren Fortschritt definiert, im Allgemeinen interpretiert -wenn auch inzwischen leicht abgewandelt: Heute gilt eine Verdoppelung innerhalb von 18 bis 24 Monaten als "Moore's Law". Doch so ausdrücklich hat Moore, 76, seine eherne Regel damals gar nicht formuliert - und im Grunde ging es ihm auch um etwas ganz anderes, wie er im stern.de-Interview erklärt.
Herr Moore, seit 40 Jahren werden Computer in rasender Geschwindigkeit schlauer. Haben Sie das wirklich so vorausgesehen?
Eigentlich wollte ich mit meinem Artikel nur klarmachen, dass durch Computerchips alles billiger wird. Damals waren integrierte Schaltkreise nämlich meist noch teurer als herkömmliche Elektronik. Aber es war abzusehen, dass diese neue Technik es uns erlauben würde, immer komplexere Geräte zu bauen - bei gleichzeitig fallenden Preisen. Ich habe mir die Entwicklung angeschaut: Es fing mit 4 Transistoren auf einem Chip an, dann waren es 8, dann 16 - ungefähr doppelt so viele Jahr für Jahr.
Und daraus schlossen Sie: Das muss dann wohl so weitergehen?
Im Grunde habe ich diese Beobachtung einfach nur blind in die Zukunft fortgeschrieben und die Vorhersage gewagt, dass wir innerhalb von zehn Jahren bei 60.000 Komponenten pro Chip ankommen würden. Ich nahm überhaupt nicht an, dass ich damit exakt richtig liegen würde, es ging mir nur um den allgemeinen Trend. Das Ganze erwies sich dann als wesentlich genauer, als es unter den Umständen hätte sein dürfen.
Zu Ihrem Glück: Schon bald wurde aus Ihrer Beobachtung ein berühmtes Gesetz - "Moore's Law" eben.
Ein Freund von mir, Professor Carver Mead, nannte das so, und der Begriff wurde zum geflügelten Wort. Das war mir anfangs sehr peinlich. Die ersten 20 Jahre lang habe ich es nie über mich gebracht, selber von "Moore's Law" zu sprechen. Irgendwann habe ich mich dann mit dem Gedanken angefreundet, und heute soll's mir recht sein, wenn in der Computerwelt alles, was exponentiell wächst, mit "Moore's Law" in Verbindung gebracht wird. (Lacht)
War Ihnen klar, welche Revolution Ihr Gesetz in unserem Alltag auslösen würde?
In dem Artikel spreche ich von Heimcomputern. Darüber war ich selbst ganz erstaunt, als ich den Text neulich nachgelesen habe. Ich wusste gar nicht, dass ich 1965 schon PCs vorhergesagt hatte. Mir ging es damals eigentlich nur darum, ein paar allgemeine Beispiele dafür zu geben, auf welchen Gebieten Computerchips nützlich sein könnten. Ein anderes Beispiel waren digitale Armbanduhren. Leider hat Intel sich darauf auch mal eingelassen. (Lacht)
Wie lange, glauben Sie, wird "Moore's Law" noch Bestand haben?
Ich habe noch nie weiter als zehn Jahre in die Zukunft blicken können, ohne Hindernisse zu sehen, die unüberwindlich schienen. Aber dann haben wir doch jedes Mal einen Weg darum herum gefunden. Einmal dachte ich, bei einem Mikrometer sei Schluss...
Mit anderen Worten: bei Schaltkreisen, die einen Tausendstel Millimeter klein sind...
Aber diese Hürde haben wir mit Leichtigkeit genommen. Dann dachte ich, ein Viertel Mikrometer - kleiner geht es nicht. Auch kein Problem. Irgendwann stoßen wir sicher an eine Grenze, aber ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zukunft schon der Fall ist. Zumindest nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre.
Und bald sind unsere Computer schlauer als wir selbst?
Ich glaube nicht, dass der Weg, den wir im Moment gehen, zu Computern mit menschlicher Intelligenz führt. Dazu braucht man einen ganz anderen Ansatz als Transistoren auf Silizium.
Warum?
Die Unterschiede zwischen einem Computer und dem menschlichen Gehirn sind einfach zu groß. Das Gehirn verarbeitet Millionen von Informationen gleichzeitig, wenn auch vergleichsweise unpräzise, beinahe schlampig. Damit leistet es das, was wir Menschen brauchen, viel besser als jeder Computer. Ich denke aber, irgendwann werden wir unseren Ansatz ändern und uns stärker an der Natur orientieren, und dann haben wir gute Chancen, etwas zu erschaffen, das menschlicher Intelligenz gleichkommt.
Das Mooresche Gesetz
Das Mooresche Gesetz besagt, dass sich durch den technischen Fortschritt die Komplexität von integrierten Schaltkreisen etwa alle 18 bis 24 Monate verdoppelt. Gordon Moore bemerkte in einem Artikel, der am 19. April 1965 in der Zeitschrift "Electronics" erschien, dass die Dichte der Transistoren auf einer Integrierten Schaltung mit der Zeit exponentiell ansteigt. Die Presse nannte diese Regelmäßigkeit dann das Mooresche Gesetz. Ursprünglich wurde von Moore eine Verdopplung alle 12 Monate vorausgesagt. Diese Vorhersage korrigierte Moore später in einem weiteren Artikel auf alle 18 bis 24 Monate.
Skeptiker erwarten eine Verlangsamung in der Integrationsdichte in naher Zukunft, dann nämlich, wenn ein Transistor die Ausdehnung weniger Atome erreicht. Außerdem wächst der finanzielle Aufwand zur Entwicklung und Herstellung integrierter Schaltkreise schneller als die Integrationsdichte, so dass es einen Punkt geben werde, an dem die Investitionen sich nicht mehr rentieren. Auch das Ende des Moorschen Gesetzes wurde schon oft vorausgesagt, aber die erwarteten technischen Probleme wurden überwunden, bevor sie relevant wurden.
Welchen Einfluss hat "Moore's Law" auf die Computerindustrie gehabt?
Das Einzigartige am Geschäft mit Computerchips ist, dass alles billiger und besser wird, indem man es kleiner macht. "Moore's Law" hat sich da von einer Beobachtung in eine Art Vorhersage verwandelt, die sich von selbst bestätigt. Es dient als Maßstab für den allgemeinen Fortschritt. Alle wissen, mit welchem Tempo es vorangeht, und was sie leisten müssen, um nicht zurückzufallen. Wer eine Generation hinter den Konkurrenten herläuft, der verliert. Also versucht jeder, ganz vorn dabeizusein. Andererseits darf man auch nicht davonpreschen, denn sonst muss man den Fortschritt allein finanzieren, und das verursacht enorme Kosten. Der Trick besteht also darin, sich immer nahe an dieser Speerspitze der Innovation zu halten. Mich selbst betrifft das allerdings nicht mehr. Ich bin ja lange heraus aus dem aktiven Geschäft und mehr so eine Art Computerhistoriker. (Lacht)
Und wozu benutzen Sie selbst die Technik, die Sie miterfunden haben?
Ich sitze immer noch viel vor meinem PC. Die Hälfte der Zeit leben meine Frau und ich auf Hawaii, und ich wüsste gar nicht, wie ich ohne E-Mail Kontakt halten sollte. Textverarbeitung mache ich natürlich auch, und ich habe viele Digitalfotos, die sich auf meinem Rechner ansammeln. Das sind so die Sachen, für die ich meinen PC nutze.
Klingt nicht gerade, als ob Sie Bedarf hätten für 40 weitere Jahre "Moore's Law".
Wissen Sie, was mich manchmal ärgert, ist die Software. Mein Computer braucht Ewigkeiten, um zu starten. Das ist wirklich frustrierend. Sonst gibt es eigentlich nichts, von dem ich sagen würde: Das fehlt mir bei meinem PC. Aber das muss nichts heißen. Ich bin sicher, irgendwer wird sich schon was einfallen lassen, das ich dann unbedingt auch haben muss.