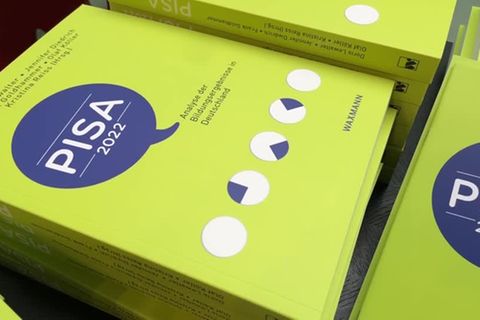Die Beamten von Kultusministerkonferenz und Bundesbildungsministeriums hatten sich viel Mühe gegeben. Folgt man ihrer wohl abgestimmten, gemeinsamen Mitteilung zur Präsentation der neuen weltweiten OECD-Bildungsvergleichsstudie, so scheint in Deutschland die Welt in Ordnung: kein PISA-Schock und keine Lehrstellenkrise, stattdessen eine schön zu lesende Bildungsbilanz. Und dort, wo man nicht ganz so glänzen kann, stellt man zumindest deutsches Mittelmaß heraus.
Doch in der Tat kann man den 500 Seiten starken Bildungsbericht der OECD auch anders lesen. Und zwar als schonungslose Abrechnung mit der deutschen Bildungspolitik der 80er und 90er Jahre, in denen der Bund mit wahren Horrorszenarien über eine drohende Akademikerschwemme möglichst viele Abiturienten vom Studium abgeschreckt und das Bafög zusammengespart hat.
Hauptschule als Schule der Zukunft
Viele Bundesländer taten ein Übriges und hielten mit künstlichen Hürden oder Quotenregelungen möglichst viele Schüler vom Besuch des Gymnasiums ab. Ungeachtet all ihrer Probleme wurde die Hauptschule als Schule der Zukunft gepriesen. Im unionsgeführten Rheinland-Pfalz mussten in den 80er Jahren Grundschullehrer zum Rapport, wenn sie etwa mehr Schüler als zuvor vom Ministerium festgelegt als "gymnasial geeignet" empfahlen. Bildungswissenschaftler sehen heute auch manches SPD-geführte Bundesland auf diesem Bremskurs in Sachen mehr Bildung. Die Übertrittsquote zum Gymnasium verharrt seit etwa zehn Jahren bei bundesweit 29,5 Prozent - während die Zahl der Schulabbrecher inzwischen auf zehn Prozent gestiegen ist.
Die Folgen der Abschreckung vor zu viel Bildung sind bekannt. Nach dem Informatikermangel und der Green-Card-Debatte macht jetzt der Ärztemangel Schlagzeilen - und nicht erst seit dem EuGH-Urteil zur Arbeitszeit in den Kliniken. Zwei mal billigten die Kultusminister in den 90er Jahren den Abbau von Studienplätzen im Mangelfach Medizin um jeweils 25 Prozent - auch wenn einige wenige Minister bis zum Schluss Widerstand leisteten. Die Folgen sind heute sichtbar: Deutschland muss in Slowenien und anderswo Ärzte anwerben. Es fehlen Ingenieure und Chemiker. Seit Jahren warnen fast alle Prognosen die Bundesrepublik vor einem dramatischen Fachkräftemangel.
Zu wenig Bildung schwächt die deutsche Wirtschaftskraft
Dabei hilft es wenig, wenn Unions- wie SPD-Minister immer wieder die hohe Zahl von deutschen Fachkräften dagegen rechnen, die - anders als im Ausland - in einer betrieblichen Lehre statt in der Hochschule ausgebildet werden. Das duale System der Berufsausbildung ist nicht nur wegen des aktuellen Lehrstellenmangels in die Krise geraten. Seit Jahren wird über große Qualitätsunterschiede geklagt. Ungeachtet dessen werden in der deutschen Statistik bei den Sekundar-II-Abschlüssen Abiturienten, hochqualifizierte Absolventen einer Metall- oder Elektrolehre aber auch der "Systemgastronom" im Schnellimbiss oder die "Dienstleistungsfachkraft im Sonnenstudio" zusammengezählt.
Mit seiner neuen OECD-Studie brachte der Bildungsexperte Andreas Schleicher es auf den Punkt: Zu wenig Bildung schwächt die deutsche Wirtschaftskraft. Während alle anderen Industrienationen in den vergangenen zwei Jahrzehnten den Bildungsstand ihrer Erwerbsbevölkerung insgesamt deutlich erhöhten und vor allem mehr Akademiker ausbildeten, herrscht in der Bundesrepublik Stagnation. Schleicher prangert seit Jahren die unzureichende deutsche Akademikerzahl an und hat auch mit der PISA-Studie den deutschen Kultusministern kein gutes Zeugnis ausgestellt. Bei einigen Kultusministern gilt er inzwischen als unerwünschte Person. Wegen seiner Zivilcourage wurde dem 39-Jährigen unlängst der Theodor-Heuss-Preis verliehen.