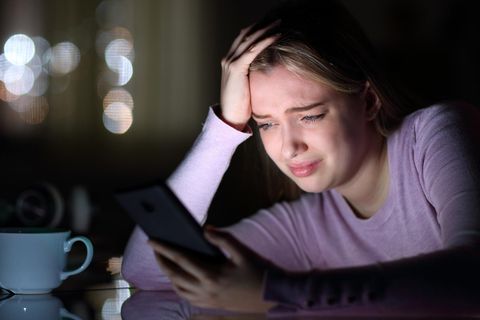Auf dem Plakat hinter dem Tresen steht: "Die ganze Schule hasst die AfD". Die Wände der Klassenzimmer sind mit Graffitis bemalt, auf den Tischen kleben Hinweise für Demos am 1. Mai, in einer Ecke steht ein Hundekorb mit Decke und ein Wassernapf: In der Berliner Schule für Erwachsenenbildung e. V. (kurz SfE) erinnert nichts an Schule im konventionellen Sinn.
Als Hanil, 27, vor fünf Jahren das erste Mal die abgewetzten Treppen in den 3. Stock hinaufstieg und durch die mit Plakaten vollgehängten Flure lief, fühlte er sich fremd. "Nicht meine Welt", dachte er. Hanil, Vater Türke, Mutter Koreanerin, wuchs in Aachen auf. Er trägt stylishe Turnschuhe, immer eine Basecap dazu schwarze Nerd-Brille. Der Hip Hopper wirkt in der Schule in einer ehemaligen Fabrik im Kreuzberger Hinterhof, als sei er per Zeitmaschine in eine links-alternative Kulisse aus den 70er Jahren zurückgebeamt worden.
Zu Hause in Aachen war er in der zwölften Klasse nach 61 Fehltagen und Konsum von Marihuana vom Gymnasium verwiesen worden. Als Hanil nach einer Woche Schwänzen seinen Lehrer im Unterricht nach einer Hausaufgabe fragte, blaffte der ihn an: "Das braucht dich nicht zu interessieren, du fliegst eh von der Schule."

Außergewöhnliches Filmprojekt
Hanil ist einer von sechs Protagonisten in dem Film "Berlin Rebel High School" von Alexander Kleider, der seit dem 11. Mai in vielen deutschen Kinos läuft. Alex, Marvin, Mimy, Lena, Florian und Hanil sind über zwanzig, alle haben die Schule geschmissen. Weil sie gemobbt wurden, mit den Lehrerinnen und Lehrern oder dem Leistungsdruck nicht zurechtkamen. Lena wuchs in Ostdeutschland in einem kleinen Dorf auf, in der Schule unter lauter Rechtsradikalen hatte sie als Punk keine Chance. Marvin hat fünf Schulen hinter sich, an keiner hat es ihn lange gehalten. In einer Filmszene erzählt er, wie ein Lehrer ihn zwang den Schulhof zu wischen, weil er auf den Boden gespuckt hatte. Doch sie alle wollen Abitur machen. Weil sie studieren oder weil sie sich einfach selbst beweisen wollen, dass sie es können. Deshalb sind sie nach Berlin gekommen, an der SfE bekommen sie eine zweite Chance.
Wie gerecht ist unsere Schule?
Im Schulalltag erleben Kinder und Jugendliche, Lehrer und Eltern immer wieder Frust: Statt an Stärken orientiert sich der Unterricht vor allem an Defiziten. Lehrkräfte fühlen sich überlastet. Mädchen und Jungen büffeln für Klausuren und Tests, statt nachhaltig zu lernen. Noten dienen zur Disziplinierung. Was muss sich ändern, damit jeder Schüler die Chance bekommt, seine Talente zu entfalten?
Schreiben Sie uns an info@stern.de.
Warum Hanil keinen Bock auf Schule hatte, obwohl ihm immer klar war, dass er Abitur machen und Maschinenbau studieren will, ihn Mathe und Physik interessieren, kann er selbst nicht recht erklären. Will er vielleicht auch nicht. Im Film erzählt Hanil aber von seiner ehemaligen Deutschlehrerin, die Kindern mit Migrationshintergrund wie ihm grundsätzlich schlechtere Noten gab und sie vor der Klasse bloßstellte. "Am Gymnasium hat sich keiner der Lehrer dafür interessiert, ob wir den Stoff verstanden haben oder nicht", sagt er. Es hat auch keiner gefragt, warum er schwänzte. Ganz anders an der Berliner Schule für Erwachsenenbildung. "Mein Deutschlehrer Klaus", erzählt Hanil, "hat mir bei dem Vergleich von Gedichten von Irmgard Keun und Bertold Brecht gesagt, was ich gut gemacht habe und was ich ausbauen kann. Er hat mich dazu gebracht, mich zu verbessern." Die Lehrer richten sich nach den Bedürfnissen der Schüler – nicht umgekehrt.
Einzige Regel: Es gibt keine Regeln
An der SfE gibt es keine Noten, Klausuren werden zum Selbstcheck als Vorbereitung auf die Prüfungen geschrieben und die Termine bestimmen die Schüler selbst. Sie können ihre Lehrer abwählen – Lehrer umgekehrt ihre Klasse absetzen. Es gibt keinen Direktor. Die einzige Regel ist, dass es keine Regeln gibt. Alles wird basisdemokratisch entschieden, Schüler und Lehrer sind vollkommen gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Auch den Unterricht gestalten die jungen Erwachsenen selbst. Es gibt klassischen Frontalunterricht genauso wie Arbeit in Kleingruppen oder in Projekten. "Keine Noten, keine Anwesenheitspflicht – das fand ich sehr verlockend", sagt Hanil. Um die Vollversammlungen alle zwei Wochen im Forum machte er am Anfang einen weiten Bogen – "alles sehr bürokratisch: Es wird beschlossen, dass überlegt werden soll", sagt er. Auch waren ihm viele seiner Mitschüler zu links, "ich bin nicht so politisch".
Die SfE entstand 1973 nach einem Streik, bei dem sich Schüler und Lehrer gegen einen autoritären Rektor auflehnten und nach Auseinandersetzungen mit der Polizei schließlich ihre eigene Schule gründeten. Kamen in den 70er und 80er Jahren die Schüler aus der alternativen Szene, um ihren Abschluss auf dem zweiten Bildungsweg zu machen, wollen das seit Einführung des Abiturkurses 1998 auch junge Leute aus der bürgerlichen Mitte. Das hat die Schule spürbar verändert.
Immer wieder kämpfen Schüler und Lehrer um die Existenz ihrer Schule, denn im Gegensatz zu anderen Privatschulen erhält die SfE keine staatliche Unterstützung. Will auch keiner. Steigende Mietkosten durch die Gentrifizierung Kreuzbergs stellen neben dem Schulgeld (derzeit 160 Euro im Monat) eine enorme Belastung dar. Außerdem gibt es kostenlose Alternativen, sein Abitur zu machen, zum Beispiel an einem der Berliner Oberstufenzentren. Die Schülerzahlen sinken: Besuchten in Spitzenzeiten mal 800 junge Erwachsene die alternative Schule, sind es derzeit knapp 200.
Berlin Rebel High School mit Auszeichnung
Daran konnte auch der Deutsche Schulpreis nichts ändern, mit diesem Gütesiegel wurde die SfE 2016 ausgezeichnet. Seit 2006 suchen und prämieren die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung jedes Jahr hervorragende und richtungsweisende Schulen. Dabei werden sie vom stern und der ARD unterstützt. Selbst im Netzwerk der Preisträgerschulen fällt die EfS aus dem Rahmen - keine andere ist wie sie. Aber von ihr können sich auch staatliche Schulen vieles abgucken: Wie Schüler frei von Angst und Leistungsdruck selbständig lernen, wie gelebte Demokratie funktioniert und Menschen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, integriert werden können. In vielem war die SfE Vorreiter, individuelles Lernen war hier schon selbstverständlich, als es für viele noch pädagogisches Neuland bedeutete.
Für Drehbuchautor und Regisseur Alexander Kleider, 41, waren die Dreharbeiten ein Wiedersehen mit seinen Lehrerinnen und Lehrern – er gehört zum Abiturjahrgang 2000 der Berliner Schule für Erwachsenenbildung. "Meine letzten Filme hatten alle schwere Themen", sagt Kleider, "jetzt wollte ich einen positiven Film machen." Er habe sich gefragt: "Was war in meinem Leben gut?" und da sei ihm vor allem die SfE eingefallen. Seine Schulzeit in Baden-Württemberg sei von Mobbing und Langeweile geprägt gewesen. "Ich habe verlernt, was ich kann, statt darin unterstützt und gefördert zu werden." Sein Kunstlehrer Klaus, inzwischen 67 Jahre alt und immer noch an der Schule, hat ihn ermutigt, Filme zu machen.
Klaus Trappmann, Deutsch- und Kunstlehrer hat über 2500 Schülerinnen und Schüler zum Abitur geführt. 12,50 Euro brutto verdient er pro Stunde. Mehr als 1300 Euro bekommt kaum eine der Lehrkräfte an der SfE im Monat. Die meisten haben noch einen Zweitjob. Seine Rente? Wird niedrig ausfallen. Aber trotzdem konnte sich der Alt-68er nie vorstellen, an einer Regelschule zu unterrichten, sagt er im Film.
Hier werden Biografien gewendet
Drei Jahre lang hat Alexander Kleider Hanil und seine Mitschüler begleitet: von der anfänglichen Begeisterung bei der "Einschulung" über die Phase der Ernüchterung bis zur produktiven Panik vor den Prüfungen. Auch wenn an der alternativen Schule alles selbstbestimmt wird, die Mittlere Reife oder das Abitur werden hier niemandem geschenkt. Denn am Lehrplan kommt auch die "Ergänzungsschule", wie die SfE im Verwaltungsdeutsch bezeichnet wird, nicht vorbei und die Prüfungen müssen extern abgelegt werden. Nur wer die vier Mündlichen besteht, wird zu den vier Schriftlichen zugelassen.
Die Schule für Erwachsenenbildung ist ein Ort an dem Biografien gewendet werden. Selbstbestimmt und selbstverantwortlich schaffen hier über 90 Prozent der Schüler ihren Abschluss, die im staatlichen Schulsystem gescheitert waren. Der Film ist daher auch eine Anklage des staatlichen Bildungssystems. Dokumentarfilmer Alexander Kleider möchte eine "Revolution anstiften" – oder zumindest eine Debatte über gute Schule entfachen.
Hanil hat an der Schule zu sich selbst gefunden und Motivation zu lernen. Für ihn war es ungewohnt, im Unterricht so viel zu diskutieren. "Das kannte ich nicht. Aber es hat mich verändert und toleranter gemacht." Gemeinsam mit Lena, der Punk, büffelte er fürs Abi und ent-warf seinen eigenen Bildungsplan. "Die Zeit hat uns zusammen geschweißt, wir sind als Gemeinschaft zusammen gewachsen – egal wie unterschiedlich wir sind", sagt Hanil. Bei den Dreharbeiten hat er zunächst nur zugeschaut und sich dann bei Alexander Kleider gemeldet um mitzumachen. "Ich habe den Film als zusätzliche Motivation genutzt: Ich wollte nicht, dass ganz Deutschland dabei zuschaut, wie ich beim Abi scheitere." Hanils Geschichte hat ein Happy End: Er studiert inzwischen im dritten Semester Maschinenbau und hat gerade geheiratet.