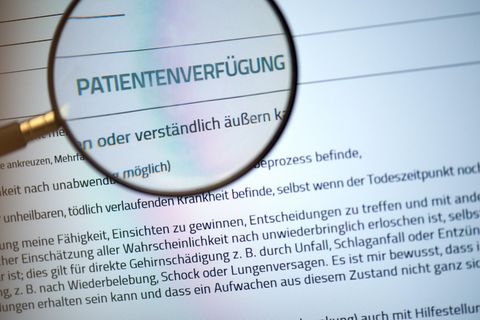Eine Patientenverfügung dient dazu, das Recht auf Selbstbestimmung auch dann wahrzunehmen, wenn man sich in Folge eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung nicht mehr selbst äußern kann. Sie macht - im Idealfall mit juristisch nicht angreifbaren Formulierungen - klar, welche Diagnosen und Therapien ein Patient wünscht oder akzeptiert und welche nicht.
Eine vernünftige Patientenverfügung können Sie nicht im Hoppla-Hopp-Verfahren errichten. Auch das "Abkupfern" eines Musters empfiehlt sich nicht. Vordrucke, die in unterschiedlicher Form und Ausgestaltung erhältlich sind, geben teilweise falsche oder überholte Inhalte vor. Eine Patientenverfügung bedarf einer gründlichen Planung in folgenden Schritten.
1. Information
Im Internet können Sie sich unter "Lebenserhaltung", "Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen", "passive Sterbehilfe", "BGB § 1901a", "Patientenverfügung", "Demenz", "Alzheimer", "Wachkoma", "Gehirnverletzung" und vielen anderen Suchwörtern informieren. Aus Büchern, Zeitschriften und Broschüren können Sie ebenfalls wichtige Informationen zu Krankheiten und Behandlungen entnehmen.
2. Beratung
Zusätzlich sollten Sie sich mit Ihrem Hausarzt über diese Thematik unterhalten, da er Ihnen medizinische Fachbegriffe erläutern kann. Ethische Fragen können Sie mit Gesprächspartnern aus Ihrer Glaubensgemeinschaft oder wertorientierten Institutionen und Organisationen erörtern.
3. Die eigene Willensbildung
Ob mündige Bürgerin oder mündiger Bürger - Sie werden sich auf Basis Ihrer Informationen und Ihrer eigenen Wertvorstellungen darüber klar werden, was Sie wollen und was Sie ablehnen. Möglicherweise lehnen Sie - wie viele andere Menschen - künstliche Ernährung und andere Maßnahmen ab, die bei aussichtsloser Besserung nicht nur die Lebens-, sondern auch die Leidenszeit verlängern. Entscheidungen in solchen Fragen sind eine sehr private Angelegenheit.
4. Entwurf eines Textes
Sind Sie sich im Klaren, was Sie wollen, können Sie einen Entwurf Ihrer Patientenverfügung erstellen oder Textpassagen sammeln.
Der letzte Weg
Tod - Begräbnis - Erbe: Der stern-Ratgeber "Der letzte Weg" erklärt, Angehörige im Todesfall tun müssen.
Linde Verlag
168 Seiten
ISBN: 978-3-7093-0479-2
9,90 € Hier bestellen
5. Abfassung
Anschließend erfolgt die endgültige Abfassung des Textes. Die Schriftform ist mittlerweile zwingend im Gesetz vorgeschrieben. Sie sollten einen Fachanwalt für Erbrecht mit der Texterstellung beauftragen oder dort Ihren eigenen Text prüfen lassen. Nur Spezialisten kennen die aktuelle Rechtslage und die rechtlichen Gründe, die zur Ungültigkeit einer Patientenverfügung führen können.
6. Unterschrift
Die Unterschrift schließt den Text ab. Nur mit Ihrer Unterschrift entfaltet die Patientenverfügung rechtliche Wirksamkeit. Ohne Unterschrift liegt nur ein unverbindlicher Entwurf vor.
7. Aufbewahrung
Abschließend hinterlegen Sie die Patientenverfügung in Ihrem Vorsorgeordner oder in Ihren persönlichen Unterlagen. Wichtig ist, dass die Patientenverfügung auch aufgefunden und den behandelnden Ärzten übergeben werden kann. Für Notfälle ist ein Hinweis auf die Patientenverfügung in Ihrer Geldbörse hilfreich.
8. Vertrauensperson
Für den Fall, dass Sie alleine in einer Wohnung leben und normalerweise niemand Zugang zu Ihren privaten Unterlagen hat, sollten Sie Ihre Patientenverfügung (in unterschriebener Kopie) auch einer Vertrauensperson übergeben, die für Sie das Dokument verwahrt und im Ernstfall behandelnden Ärzten vorlegt. Eine in einer privaten Wohnung ohne Ihre Mitwirkung nicht auffindbar hinterlegte oder gar in einem Banksafe verwahrte Patientenverfügung kann keine Wirkung entfalten, weil sie nie dorthin gelangt, wo sie beachtet werden soll (in eine Arztpraxis, Klinik oder ein Pflegeheim, zum zuständigen Betreuungsgericht). Idealerweise ist die Vertrauensperson auch Ihr Bevollmächtigter.