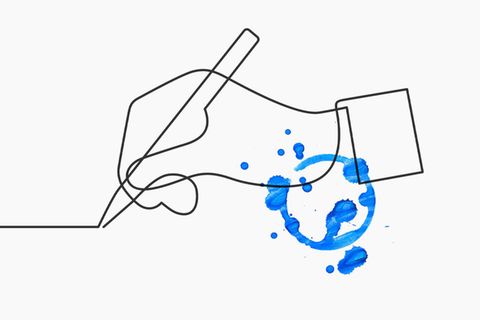Gerd Hankel (65) ist Afrika auf zwei Weisen verbunden: Als Völkerrechtler untersuchte er den Völkermord in Runda und veröffentliche 2016 ein Buch über das Leben und den Neuaufbau des Landes nach den grausamen Bürgerkrieg, der in vier Monaten rund 800.000 Menschen das Leben kostete. Hankel beschäftigte sich vor allem mit der Rolle der Gacaca-Gerichte bei der Aufarbeitung der Massaker. Diese traditionellen ruandischen Dorfgerichte zielen nicht auf die Bestrafung der Täter, sondern auf die Wiederherstellung das sozialen Friedens. Privat unterstützt er mit dem Hamburger Verein "Initiative Kongo" Schulprojekte im Nachbarland Ruandas. Seine Erfahrungen und Erlebnisse fasste er 2020 im Buch "Das Dilemma - Entwicklungshilfe in Afrika" zusammen. Darin schildert Hankel drastisch und durchaus mit einer Portion Polemik, woran aktuelle die Entwicklungshilfe scheitert. Er sagt aber auch, wie sie besser funktionieren könnte und warum Schulprojekte, so klein sie auch sein mögen, immer einen positiven Beitrag leisten.
Afrika ist kein Land, doch dass denken viele Deutsche unbewusst, wenn sie über einen Kontinent mit 54 Einzelstaaten sprechen, auf dem die USA und China Platz fänden. Woran liegt das, ihrer Meinung nach?
Das liegt an einer oft unterschwelligen weißen Arroganz, glaube ich. Man sagt Afrika leicht so dahin, ohne überhaupt die Dimensionen zu verstehen und gleichzeitig beanspruchen wir damit zu wissen, was gut für Afrika ist. Das Problem ist aber auch, dass wir es auf der anderen Seite oft mit afrikanischen Eliten zu tun haben. Diese Eliten haben im Westen studiert, sprechen fließend Englisch oder Französisch, sie sind uns ähnlich. Tatsächlich jedoch haben sich diese Gruppen von der Lebenswirklichkeit in ihren Ländern abgekoppelt.
Und daran scheitern dann Projekte?
Nun, scheitern gibt es eigentlich nicht. Das liegt in der Natur der Vergabeverfahren. Es wird Geld etwa investiert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und die Investoren wollen natürlich gute Nahrichten hören. Die Projektverantwortlichen vor Ort wollen Erfolge vermelden, weil sie natürlich an Folgeaufträge denken. Ich habe es sehr selten erlebt, dass Projekte vorzeitig beendet worden sind.
Wie äußert sich denn "weiße" Arroganz?
Oft wird die Vorstellung einer deutschen Schule eins zu eins auf die Schulprojekte in Afrika übertragen. Zum Beispiel in der Projektanforderung für Schulen nach gendergerechten Toiletten. Wenn sie das nicht in ihrem Projektplan zusichern, dann bekommen sie den Zuschlag nicht. Oder das BMZ besteht darauf, dass die Projektvergabe, zum Beispiel ein Bauauftrag, im Kongo genau nach den gleichen Regeln wie in Deutschland erfolgen soll. Doch so funktioniert das nicht. Da ist auch eine Menge Selbstbetrug im Spiel.
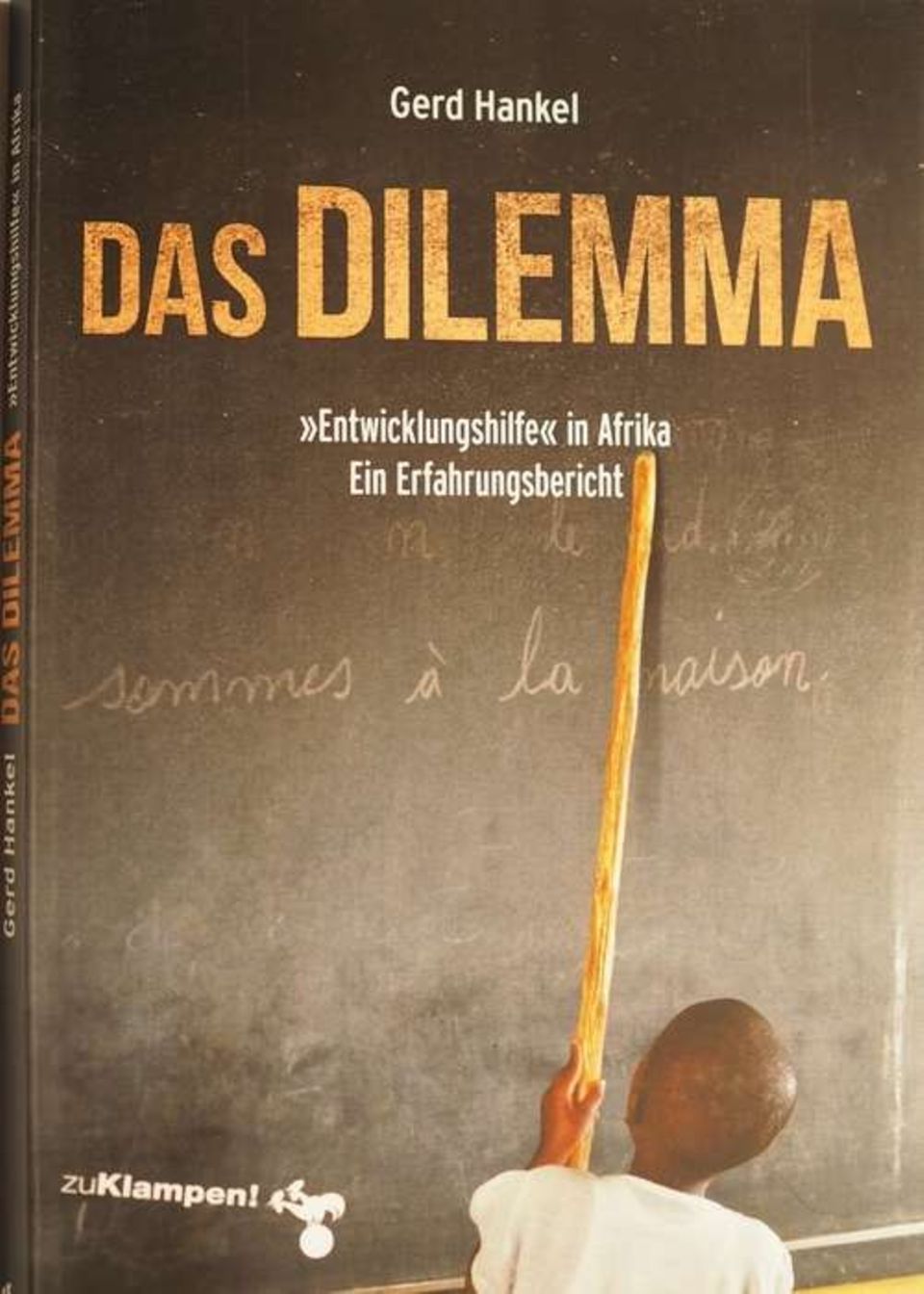
Das Dilemma. "Entwicklungshilfe" in Afrika. Ein Erfahrungsbericht
Taschenbuch, zuKlampen Verlag 2020
148 S., ISBN 978-3-86674-607-7
Während andere Entwicklungsregionen wie Asien oder Südamerika prosperieren, scheint vor allem Afrika südlich der Sahara kaum vom Fleck zu kommen. In öffentlichen Debatten wird oft der Kolonialismus und die wirtschaftliche Ausbeutung als Hindernisse genannt. Wie sehen Sie das?
Jahrzehnte nach der Kolonialzeit noch den Kolonialismus für das Elend verantwortlich zu machen, kann man nicht mehr ernst nehmen. Der Präsident von Ruanda Paul Kagame wird richtig wütend, wenn jemand mit dem Kolonialismus Missstände im Land begründet. In vielen Staaten ist das Elend hausgemacht. An erster Stelle steht die Korruption in einem gewaltigen Ausmaß. Korruption ist eine Folge der Armut. Und Armut wiederum untergräbt das Gefühl für das Gemeinwohl. Man ist derart beschäftigt, sich selbst über die Runden zu bringen, dass wenig Platz für andere bleibt. Und die, die es in der Hand hätten das zu ändern, agieren als Eliten wie die alten Kolonialherren. Der politischen Elite des Kongo zum Beispiel ist die eigene Bevölkerung völlig egal. Präsident Joseph Kabila zweigte aus Staatseinnahmen etwa eine Milliarde US-Dollar für sich ab – pro Jahr. Vor diesem Hintergrund ist es doch beschämend, wie wenig sich das Land um die Bildung seiner Kinder kümmert.
Aber in den Verfassungen vieler afrikanischer Staaten, auch den Ärmsten, ist die Schulpflicht festgeschrieben und sehr häufig sogar die Grundschule kostenlos.
Stimmt, aber hier klaffen Papier und Wirklichkeit sehr weit auseinander. Gerade auf dem Land gibt es keine Schulen und wenn, dann mangelt es an Lehrern. Ich habe es selbst vielfach erlebt. Da sitzt man mit seinem Schulanliegen einem Beamten im Bildungsministerium gegenüber, der seit drei, vier Monaten kein Gehalt bekommen hat. Der hört einem erst dann zu, wenn man ihm Geld über den Tisch schiebt. Er will seinen Anteil, so ist das da.
Wollen die Eliten ein instabiles System damit sie weiterhin frei schalten und walten können?
Nein, das ist kein kalkuliertes Ziel. Es ist eher eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Zwar wird Ihnen ein kongolesischer Politiker wortreich erzählen, wie er sich für die Bevölkerung einsetzt, tatsächlich denkt er zuerst an die Versorgung seines Clans, dann an die Absicherung seiner Macht und das Ausschalten von Konkurrenten. Und selbst wenn etwas in der Hauptstadt Kinshasa politisch entschieden wird, dauert es ewig, bis das in den weiter entfernten Winkeln dieses Flächenlandes ankommt. Wenn überhaupt. Oft verfolgen die Provinz-Gouverneure andere Vorstellungen.
Also sind Länder wie der Kongo nach unserem Verständnis keine Staaten?
Im Kongo und zahlreichen anderen Ländern ist genau das der Fall. Das Verständnis davon, dass der einzelne Kongolese und die Kongolesin ein Individuum mit Rechten ist und berechtigte Ansprüche an den Staaten hat, ist bei den Eliten sehr schwach ausgeprägt. Und welche Loyalität soll ein kongolesischer Bürger entwickeln, wenn sein Staat nicht einmal für seine Sicherheit sorgen kann? Weder Sicherheit vor Gewalt noch Rechtssicherheit. Insofern ist der Staat etwas, mit dem der Kongolese am besten nichts zu tun haben will.
Und dann gibt es Nachbarstaaten, die ein stabiles Staatswesen entwickeln konnten, wie Botswana. Partizipation aller Gruppen an der politischen Macht, die beiden größten Haushaltsposten sind Soziales und Gesundheit.
Botswana ist eine Lichtgestalt unter den afrikanischen Staaten in vielerlei Hinsicht. Die haben es geschafft, die Steuereinnahmen aus dem Rohstoffhandel sozial zu investieren und die Korruption zu bekämpfen. Das könnten Länder mit ähnlichen Reichtümern auch, doch da steht dann die Vetternwirtschaft, Tribalismus und das Geflecht aus gegenseitigen Abhängigkeiten im Weg.
Welche Staaten sind denn noch auf gutem Weg wenn es um Bildung und Stabilität?
Ghana, Kenia, Uganda, Botswana aber auch Ruanda haben erhebliche Fortschritte gemacht.
Die Entwicklung in Ruanda scheint angesichts des brutalen Genozids doch erstaunlich.
Das liegt auch an den besonderen Faktoren dort. Ruanda ist ein kleines Land, gerade einmal so groß wie Hessen. Das macht die Verwaltung einfacher. Die Verwaltung ist in Ruanda ohnehin hoch effektiv. Ansagen eines Ministeriums erreichen selbst die kleinsten Einheiten recht schnell und können nachgehalten werden. Zudem flossen nach dem Völkermord sehr viele internationalen Hilfen in das Land, die in nachhaltige Projekte investiert wurden, vor allem in die Bildung.
War das der Schlüssel zum Erfolg?
Ja und nein. Man hatte leider die Schulbildung zu sehr auf akademische Abschlüsse ausgerichtet. Eigentlich eine feine Sache, doch heue gibt es in Ruanda mehr Hochschulabsolventen als passende Arbeitsplätze. Die offiziellen Zahlen der Jungendarbeitslosigkeit liegen war deutlich niedriger, doch ich würde sie eher auf 40 bis 50 Prozent schätzen. Das passt man langsam an, zum Beispiel mit der aus Deutschland stammenden dualen Ausbildung, bei der Schule und Berufsausbildung miteinander verzahnt sind.
Neben den Uno-Organisationen betrieben eine ganze Reihe von NGOs Schulen in den Subsahara-Staaten oder sie vermitteln Patenschaften, damit Kinder zu Schule gehen können. Sind das nicht Tropfen auf heiße Steine? Was bringen 300 Kinder in einem Schulprojekt, wenn ein Land wie etwa der Kongo nicht in der Lage ist, jährlich seine 300.000 Erstklässler einzuschulen?
Doch das bringt etwas. Gerade Schulprojekte sind immer sinnvoll. Jede Veränderung zum Guten in einem Land beginnt mit Bildung. Erst mit ihr ist Erkenntnis möglich. Erkenntnis bedeutet hier, überhaupt die Misere zu erkennen, in der man lebt. Habe ich das erkannt, dann folgt daraus oft der Wille zur Veränderung. Das habe ich oft in eigenen Projekten erfahren. Diese Kinder stellen Fragen, sie wollen mehr. Und nur so geht das. Sollen Veränderungen nachhaltig sein, dürfen sie nicht von außen aufgepfropft werden. Es muss aus der Gesellschaft selbst kommen. Und darum sind Schulprojekte wichtig, auch die kleinen.
In den vergangenen Jahren haben sich die Hilfsorganisationen vor allem auf die Bildung von Mädchen konzentriert. Ist das nicht vermessen in Ländern, in denen es weder für Jungs noch für Mädchen ausreichend Schulbildung gibt?
Es gibt gute Punkte dafür, die Mädchen in den Mittelpunkt zu rücken. Mädchen oder Frauen beeinflussen das soziale Gefüge sehr stark. Sie bekommen die Kinder, sie erziehen die Kinder, sie organisieren den Haushalt. Im Kongo aber auch anderen afrikanischen Ländern sind die Frauen die starken Persönlichkeiten. Für die meisten Mädchen folgt nach der Schule die Mutterschaft. Doch wenn sie schon wissen, dass mit fünf oder mehr Kindern die Armut programmiert ist, dann stehen die Chancen gut, dass es nicht so viele werden. Auch das ist ein Gewinn.
Schule ist nicht gleich Schule. Wie steht es denn um die Güte des Unterrichts?
Stark vereinfacht betrachtet gibt es zwei Ausrichtungen in der Unterrichtsgestaltung, die beide auf die Kolonialzeit zurückgehen. In den frankophonen Staaten herrscht ein klassischer Frontalunterricht. In den ehemals britischen Kolonien ist der Unterricht eher auf Kreativität und eigenständige Problemlösung ausgerichtet. An kongolesischen Schulen steht der Lehrer vor der Klasse und schreit herum. Lehrer sind knapp und ihre Ausbildung lässt sehr oft zu wünschen übrig. Eine fundierte Lehrerausbildung wäre auch ein wichtiger Hebel bei Schulprojekten.
Angesichts von Korruption und einem wenig ausgeprägten Verantwortungsgefühl bei afrikanischen Staatslenkern, wie sollte denn Hilfe im besten Falle aussehen?
Man solle aufhören, nur von einer Seite Projekte zu finanzieren. Was nichts kostet, wird gern mitgenommen, ist aber auch nichts wert. Das müsste durchbrochen werden. Ob jetzt Schulen oder andere Vorhaben, der betreffende Staat sollte sich zur Hälfte daran beteiligen. Man muss die Behörden in den afrikanischen Ländern zwingend mit in die Verantwortung holen. Zudem sollten von vornherein Mitarbeiter aus der Basis bei der Planung miteinbezogen werden. Menschen, die aus erster Hand die Lebenswirklichkeit dort kennen und beurteilen können, was und was nicht möglich ist. Das ist bei der heutigen Projektentwicklung oft nicht der Fall.