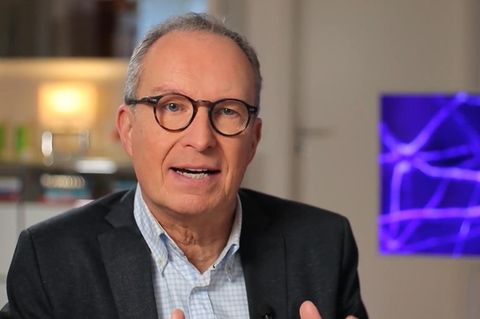Allergische Krankheiten nehmen in den westlichen Industriestaaten explosionsartig zu. In den vergangenen 30 Jahren hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt. Experten der Hautklinik des Magdeburger Universitätsklinikums untersuchen, warum jeder vierte Bundesbürger unter Krankheiten leidet, von denen unsere Großeltern kaum etwas zu wissen schienen.
Es gebe zahlreiche Ursachen, die sich auf veränderte Lebenumstände und die Zunahme von Umwelt-Allergenen zurückführen ließen, erklärt Professor Bernd Bonnekoh. Fest stehe, dass die Volkskrankheiten Neurodermitis, Heuschnupfen und exogenes allergisches Asthma, zusammengefasst unter dem Fachbegriff Atopie, genetisch determiniert seien, ergänzt Andreas Ambach. Etwa 25 Prozent der Bevölkerung tragen den Experten zufolge die vererbte Anlage in sich. Ob eine Atopie tatsächlich ausgeprägt werde, hänge jedoch entscheidend von Umweltfaktoren ab.
Krankheitssymptome bei harmlosen Stoffen
Allergiker reagieren auf bestimmte Stoffe, die eigentlich harmlos sind, mit Krankheitssymptomen. Inzwischen sind über 20.000 Allergie auslösende Stoffe, so genannte Allergene, bekannt, so in Blütenpollen, Schimmelpilzen und Nahrungsmitteln. Eine Rolle spiele auch die zunehmende Chemisierung der Umwelt, die Störung des Ozons in der Atmosphäre und Veränderungen der Raumluft durch Klimaanlagen.
Der Allergiker atmet diese Allergene und »Irritantien« ein, isst oder berührt sie. Das Immunsystem spielt verrückt. Es verwechselt beispielsweise die Bestandteile von Birkenpollen mit gefährlichen Krankheitserregern und greift sie an. Das Abwehrsystem bildet eine besondere Art von Antikörpern, das Immunglobulin E (IgE). Dieses Allergieeiweiß setzt Botenstoffe wie Histamin aus Mastzellen frei. Eine besondere Rolle kommt nach den Erkenntnissen der Magdeburger Wissenschaftler dabei neben den Mastzellen auch den zytotoxischen T-Zellen zu, die bei Allergiepatienten massiv gestört sind. So komme es zur verstärkten Freisetzung des Boten-Moleküls Perforin und zur Übererregbarkeit. In der Folge werden die Gefäße weiter, Haut und Schleimhaut schwellen an. Symptomen sind triefende Nasen, Hautreaktionen wie Neurodermitis und Nesselfieber, Asthma, Magen-Darm-Beschwerden, Heuschnupfen oder Schwellungen im Mund- und Rachenraum.
»Der Schutz gegen Allergien wird in der frühen Kindheit ausgeprägt«, sagt Bonnekoh und verweist dabei auf internationale Daten. Wenn sich das Immunsystem des Kleinkindes mit Infektionen und Parasitosen auseinander setze, werde es wie ein Zehnkämpfer in verschiedenen Sportarten gegen die Allergene trainiert.
Vor der Behandlung einer Allergie macht sich der Arzt auf die Suche nach deren Auslöser. »Für die Diagnose ist eine fast detektivistische Anamnese notwendig«, erklärt Bonnekoh. Wesentlich seien Informationen zu Lebensumständen und Krankengeschichte, um die in Frage kommenden Substanzen einkreisen zu können. Mit einem Hauttest werde die Sensibilisierung auf einzelne Stoffe überprüft. Üblich sei der Pricktest, bei dem die gelöste Substanz auf den Unterarm getropft und dieser anschließend mit einer Nadel angestochen werde. Bildet der Organismus Antikörper gegen den Stoff, entstehen nach kurzer Zeit rote Quaddeln an der Einstichstelle. Zum Nachweise von Kontaktekzemen beispielsweise auf Nickel in Modeschmuck dient der Epikutantest, bei dem die Testlösung mit einem Pflaster aufgetragen wird, wie Ambach erläutert. Mit Blutuntersuchungen komme man dem Immunglobulin E auf die Spur.
Den Körper umerziehen
So vielfältig wie die Auslöser von Allergien sind auch die Therapien. Ist die krank machende Substanz gefunden worden, sollte der Allergiker zunächst versuchen, diese zu vermeiden. Vielen Allergenen könne man jedoch nicht vollständig aus dem Wege gehen, räumt Bonnekoh ein. Bei Pollen beispielsweise empfiehlt der Experte Antihistaminika in Sprayform für die örtliche und als Tabletten für eine systematische Behandlung. Die Antihistaminika blockieren die Rezeptoren des Histamins im Gewebe und verringern so die allergischen Symptome. Bei schweren Allergien müsse auf fortschrittlich Kortisonpräparate zurückgegriffen werden.
Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, schlägt Professor Bonnekoh eine Hyposensibilisierung vor. Bei dieser spezifischen Immuntherapie wird dem Allergiker das betreffende Allergen in steigender Kozentration injiziert. Der Körper werde umerzogen und gegen die Substanz unempfindlicher gemacht. Bei der Insektenstich-Allergie beispielsweise könne man mit einem Behandlungserfolg von 90 Prozent rechnen.
Von Birgitt Pötzsch, AP