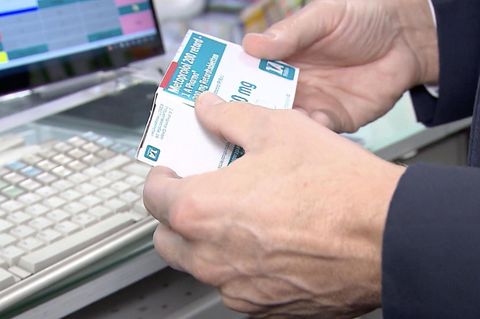Die Ärzte in Deutschland verschreiben häufig neuartige Arzneimittel, obwohl sie gegenüber herkömmlichen Präparaten kaum einen Zusatznutzen bringen. Arzneimittel ohne Mehrwert wiesen beträchtliche Verordnungszuwächse auf, heißt es in einer DAK-Studie zur gesetzlichen Neuregelung des Arzneimittelmarktes. Nicht alle neuen Medikamente, die auf den Markt kommen, brächten für den Patienten auch einen echten Fortschritt in der Therapie, lautet das Fazit der Studie.
Das 2010 vom Bundestag beschlossene Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (Amnog) legt fest, dass der Hersteller den Preis nicht mehr alleine bestimmen kann; vielmehr muss auf Grundlage der Nutzenbewertung mit den Kassen verhandelt werden. Der DAK-Report ergab, dass nur jeder zweite untersuchte Arzneimittelwirkstoff einen Zusatznutzen aufweist.
Kritische wissenschaftliche Bewertung
"Insgesamt erweist sich das Amnog als sozialpolitisch erfolgreich und sinnvoll, weil die wissenschaftliche Bewertung von neuen Arzneimitteln die Spreu vom Weizen trennt", erklärte der Chef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Herbert Rebscher. "Allerdings zeigt der Report auch Schwachstellen auf, die in diesem lernenden System gemeinsam gelöst werden müssen."
Als Beispiel nennt die DAK-Studie das Multiple-Sklerose-Medikament Fampyra. Der Umsatz dieses Mittels habe sich in den beiden Jahren nach der Prüfung verzehnfacht, obwohl kein Zusatznutzen festgestellt worden sei. "Die kritische wissenschaftliche Bewertung der Präparate würde ein anderes Verordnungsverhalten der Ärzte erwarten lassen", sagte Rebscher. "Das Amnog-Prinzip ist gut und richtig", erklärte der Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, Florian Lanz. Es gebe hohe Erstattungsbeträge, wenn das neue Medikament einen großen Zusatznutzen für Patienten habe, und relativ geringe, wenn der Hersteller keinen oder nur einen geringen Zusatznutzen nachweisen kann. Er kritisierte allerdings, dass die Krankenkassen ein Jahr lang jeden Preis bezahlen müssen, den ein Pharmaunternehmen verlangt.
Die Amnog-Verhandlungen zwischen Pharmaunternehmen hätten sich bewährt, erklärte Lanz. Bis Ende 2014 hätte bei 68 Verhandlungen in 59 Fällen eine Einigung erzielt werden können. Lediglich in neun Fällen sei eine Entscheidung durch die dafür vom Gesetzgeber vorgesehene Schiedsstelle nötig gewesen.