Der Kasten erinnert ein wenig an einen Streich von Chemiestudenten, die nach erfolgreicher Masterarbeit im Labor alle Schläuche, Ventile und Röhrchen wahllos zusammengesteckt, in einem Glasschrank verstaut und feixend einen Trichter draufgesteckt haben. "Das hier ist unser künstlicher Darm", stellt Doktor Bernd Stahl nicht ohne Stolz die Installation vor. "Nur der der Dünndarm", er zeigt mit den Händen auf seinen oberen Bauch. "Der Dickdarm steht weiter hinten." Dort gehe es "dreckiger" zu, die Gefahr von Kontaminierungen sei zu groß und die Verunreinigungen könnten die Forschungsergebnisse verfälschen. An den künstlichen Därmen erproben die Forscher und Forscherinnen, ob ihre Entdeckungen auch tatsächlich funktionieren. Es kommt eben doch darauf an, was hinten rauskommt. Vor allem beim Lebensmittelhersteller Danone. Das lichtdurchflutete Nutria Research Center mitten im geschäftigen Unigelände Utrechts gehört zum französischen Konzern, der vor allem durch Joghurts wie Activa, Actimel und Alpro bekannt ist.

Die Lage im Univiertel hat für den Forschungszweig von Danone gleich zwei Vorteile. Viele der Ernährungs-Experten sind als Referenten oder Gastprofessoren an verschiedenen Fakultäten der Universität Utrecht tätig. Die Arbeit festigt die Reputation des Unternehmens im wissenschaftlichen Betrieb und sie erleichtert das Anwerben von gut ausgebildeten Nachwuchskräften. So machen einige Studenten ihre Doktorarbeit bei Nutricia.
Im 2013 errichteten Gebäude scheinen die meisten Wände aus Glas. Es ist hell, luftig, im Wortsinn transparent. Wer vom Atrium nach oben schaut, sieht an den Glaswänden der einzelnen Stockwerke in großen weißen Lettern gleich die "Inhaltsangabe" der jeweiligen Etage: Product Development, Analytical Science, Life Science. Große Räume mit Arbeitstischen, Monitoren und zahlreichen Analysegeräten. Eine etwa 50 Meter lange und zehn Meter hohe Glasfront gewährt den Blick auf die Anlage der Test-Produktion.
Danone lebt von Spezialnahrung wie Muttermilchersatz
Nur das Wort Danone sieht man allenfalls auf Joghurtbechern in der Kantine. Das Forschungszentrum gehört zu Nutricia, jenem Zweig von Danone, der Spezialnahrung erforscht, entwickelt und überprüft, ob sich die Laborprodukte überhaupt im großen Maßstab herstellen lassen. Nutricia hat deutsch-niederländische Wurzeln, entstanden aus der Übernahme von Milupa und Pfrimmler durch den niederländischen Konzern Numico. 2007 wurden die Niederländer von Danone gekauft. Eine europäische Firmengeschichte: Geführt wird in Frankreich, geforscht in den Niederlanden und produziert vor allem in Deutschland.
Ein erheblicher Anteil des Umsatzes von rund acht Milliarden Euro weltweit erzielt Danone mit Spezialnahrung: Die reicht von der Milch für Frühgeborene bis zur medizinischen Zusatznahrung für Krebspatienten in der Therapie. Hier kommt es nicht nur auf den Geschmack sowie Konsistenz an, sondern auf die Güte der Inhaltsstoffe, deren Verträglichkeit und ihrem positiven Beitrag bei der Wiederherstellung der Patienten. Grundlage dieser Produkte ist unter anderem die Erforschung der menschlichen Muttermilch.

Bernd Stahl leitet die Muttermilchforschung. Wenn Muttermilch sein Geschäft ist, warum begeistern ihn künstliche Därme? Weil mit der Muttermilch alles beginne, sie sei Teil der Startprozedur für das neugeborene Leben. "Ein Baby kommt nahezu steril auf die Welt, der überhaupt erste Schub an Bakterien erhält es bei der Geburt und danach vor allem durch die Muttermilch", erklärt Stahl. Es ist die Initialzündung für die Besiedelung des Darms mit lebensnotwenigen Bakterien. Ohne Microbiota, wie die Darmflora heute heißt, aus guten und schlechten Bakterien im harmonischen Gleichgewicht funktioniert nicht nur die Verdauung eingeschränkt, auch das Immunsystem wird schwächer.
Wie die Muttermilch das genau in Gang setzt, ist immer noch in weiten Teilen ein Rätsel. Eines, dem Stahl und sein Team mit HighTech auf die Spur kommen wollen. Von außen sehen die Massenspektrometer MALDI und ESI so unspektakulär aus wie graubeige Büroelektronik aus den späten Neunzigern. Tatsächlich sind sie die feinsten derzeit vorstellbaren Waagen. Mit ihnen können Bestandteile der Muttermilch bis in den Sub-Nanogrammbereich "gewogen" und bestimmt werden. Was für den Maurer die Kelle und den Pianisten der Flügel ist für Bernd Stahl das Massenspektrometer. Seit mehr als drei Jahrzehnten spürt der Biologe aus Münster mit dieser und anderen Techniken Molekülen in natürlichen Quellen nach, vor allem in der Muttermilch.
"Muttermilch ist ein Geniestreich der Natur"
Muttermilch besteht aus Fetten, Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Allem, was ein Säugling in den ersten sechs Monaten zum Wachstum braucht. Rund 1800 dieser Makromoleküle wurden bereits charakterisiert. Eine Gruppe davon ist für die Forschung besonders interessant: die HMO, die Humanen Milch-Oligo-Saccharide. Oligio steht für mehrfach und Saccharide sind Zucker, eine Untergruppe der Kohlenhydrate. Gleichwohl die HMO aus lediglich fünf Grundbausteinen bestehen, können sie unterschiedlich verkettet, hunderte Varianten mit einzigartigen Eigenschaften bilden.
Erste HMOs wurden bereits 1930 beschrieben und ab etwa 1950 entdeckte man, wie sie bei der Bildung der Darmflora bei Neugeborenen wirken. Seither wird international an der Entschlüsselung der Muttermilch geforscht. Milch von Kühen oder Ziegen sind kein Ersatz für diese HMOS. Sie enthalten anders aufgebaute nicht verdaubare Oligosaccharide. Dank neuer Analyseverfahren konnte die Forschung in den vergangenen Jahren die Zusammenhänge noch genauer verstehen. Derzeit sind rund 250 einzelne HMO-Strukturen in der Muttermilch bekannt. Die Spitze des Eisbergs. "Die Messungen zeigen, es müssen noch sehr viel mehr dieser Bausteine existieren, die wir bisher nicht identifizieren konnten, von denen wir nicht einmal wissen, was sie bewirken", schwärmt der Biologe.
Muttermilch ist wie eine Initialzündung für den Darm
Anfangs waren die Forscher überrascht, wie die HMO überhaupt die Verdauung beeinflussen können, schließlich verfügt der Mensch nicht über die notwendigen Enzyme zur Aufspaltung dieser Zucker. Sie widerstehen selbst der Magensäure und auch der Dünndarm beißt sich an ihnen die Zotten aus. Sie rauschen durch bis in den Dickdarm des Kindes. Doch genau hier entfalten die HMO ihre Wirkung. Der Mensch selbst kann sie zwar nicht verstoffwechseln, aber das Bifidobakterium im Dickdarm kann es. Diese Bakterienart zählt zu den Guten und der mit Abstand größten Gruppe im Darmbiom, der Gemeinschaft aus unterschiedlichsten Bakterien, Pilzen und Viren. Bestimmte HMO in der Muttermilch sind begehrte Nahrung für die Bifidobakterien. Sie können sich so schneller vermehren als ihre schädlichen Gegenspieler, was zur Ausbildung einer gesunden Darmflora beiträgt.
Mit großem Appetit vertilgen sie diese Zucker im Dickdarm. Auf dem "Weg nach unten” helfen sie unter anderem bei der gezielten Abwehr von Krankheitskeimen. Die gesamte Oberfläche des Magen-Darmtraktes enthält Zuckerketten, an die Krankheitserreger andocken, um von dort aus in den Körper einzudringen. Die HMO sind diesen Kontaktstellen sehr ähnlich, so dass die Keime bevorzugt an den HMO anlagern. Sie landen so nicht im Körper, sondern dort, wo sie besser aufgehoben sind: in der Windel. Nachweislich haben gestillte Kinder ein deutlich geringeres Risiko für Darmentzündungen und Durchfallerkrankungen. Auch wirken HMO antimikrobiell und können sogar das Pilzwachstum ausbremsen.
Ziel der internationalen Muttermilchforschung ist es herauszufinden, welche Oligosaccharide nun genau welche Vorgänge im Körper auslösen. Denn die Förderung der Bifidobakterien ist nur ein Vorgang in einem vielschichten Konzert zahlreicher weiterer Prozesse, an denen HMO beteiligt sind. "Diese Forschung braucht Zeit, wir denken da in Dekaden", erklärt Stahl.
Dabei gehe es ja nicht nur um die Vorgänge im Darm. Es sei immer noch nicht völlig verstanden, wie die Milch im Körper der Mutter gebildet wird. So fänden sich in der Milch ebenfalls Bifidobakterien der Mutter, die sich ihren Weg aus dem Darm, in die Lymphen und von dort in die Brustdrüsen gebahnt haben. Analysen hätten gezeigt, dass die Muttermilch ihre Zusammensetzung ändert, um das Immunsystem eines erkrankten Kindes zu unterstützen. Es muss folglich eine chemische Kommunikation zwischen Mutter und Kind beim Stillen geben. Wie das funktioniert? Stahl zuckt mit den Schultern. "Wir wissen es noch nicht. Muttermilch ist einfach ein Geniestreich der Natur". Selbst während des Stillens ändere sich ihre Zusammensetzung. Die Milch kurz nach dem Anlegen sei eine andere als am Ende des Stillens.
Gewonnen wurden solche Erkenntnisse über Jahre durch die Analyse klinischer Stillstudien und über genau dokumentierte Muttermilchspenden. Nutricia kooperiert dabei als Teil der Forschungsgemeinschaft mit Entbindungskliniken in Deutschland. Die Proben werden also nicht exklusiv an die Danone-Tochter weitergeben, alle beteiligten Institute profitieren. "Da sich die Milch in ihrer Zusammensetzung ändert, muss schon auf der Station der Kliniken genau protokolliert werden, wann und in welcher Phase des Stillens die anonymen Proben genommen wurden. Es ist ein kleiner Katalog an Daten notwendig, damit wir mit den Proben überhaupt aussagekräftige Testreihen aufsetzen können", erklärt Doktor Marko Mank, der Leiter der Discovery-Analyseabteilung. Die Muttermilchforschung trägt auch dazu bei, dass der Stillraum im Research Center besonders hoch frequentiert wird. Hier können die Mütter wie in vielen Danone Standorten unter besten Bedingungen Milch abpumpen für ihre Babys.
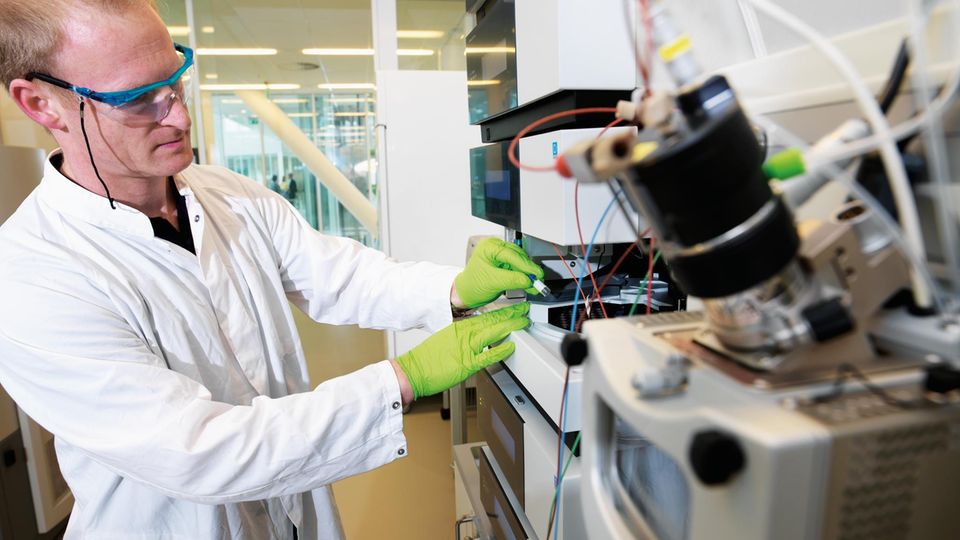
Genauigkeit ist ein zentrales Thema, insbesondere bei Forschungseinrichtungen aus deren Ergebnissen dann Produkte für Säuglingsnahrung entstehen sollen. Ziel ist es, Ersatznahrung anbieten zu können, die zumindest über ein paar der Eigenschaften echter Muttermilch verfügt. Den Aufbau einer Darmflora zum Beispiel. "Wenn wir bestimmte Saccharide in der Milch identifiziert und ihre Funktion verstanden haben, dann folgt die Überlegung, wie diese Moleküle künstlich gewonnen werden können", erläutert Mank. Der bisher größte Erfolg ist die Entwicklung einer Ballaststoffmischung aus Galactooligosacchariden (GOS) und Fructooligosacchariden (FOS), um den positiven Effekt der Muttermilch beim Aufbau der Darmflora und damit auch indirekt dem Immunsystem nachzubilden. Die langkettigen FOS werden aus Chicorée gewonnen, GOS aus dem Milchzucker Laktose. Derzeit wird an Oligosacchariden geforscht, die beim Aufbau der weiteren Immunabwehr helfen.
Muttermilchforschung ist emotional aufgeladen
Ungeachtet der Erfolge wissen die Muttermilchforscher: Ihr Arbeitsgebiet ist sensibel, emotional aufgeladen und hochpolitisch. Die Skandale aus den siebziger Jahren wirken noch nach. In den "wilden" Siebzigern lösten sich weltweit immer mehr junge Frauen von der zuvor tradierten Mutterrolle. Milchpulver und künstliche Säuglingsnahrung standen hoch im Kurs. Immer weniger Frauen stillen, warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO damals. Die Werbung für Babynahrung war so reguliert wie die von Tabak und Alkohol: gar nicht. Erst 1981 erließ die WHO einen verpflichtenden Kodex für die Vermarktung von Säuglingsnahrung. In Deutschland regelt das "Säuglingsnahrungswerbegesetz" seit 1994 präzise, was Firmen über ihre Produkte sagen dürfen. Die WHO fördert seither unter dem Motto "Breast is the best" das Stillen.
Bernd Stahl kann dem nur zustimmen, als Forscher und als Vater. Muttermilch sei das Beste, der Gold-Standard. Aber, so sagt er, was können wir jenen Müttern anbieten, die nicht stillen können? Die Gründe nicht Stillen zu können sind zahlreich: Schilddrüsenfehlfunktion, die Einnahme von Medikamenten wie Blutdrucksenker, Verletzungen der Brustwarzen oder Diabetes. Und manchmal will die Milch auch ohne erkennbare organische Ursache einfach nicht fließen. Eine enorme seelische, aber auch soziale Belastung für viele Mütter. Dann heißt es Zufüttern mit einer Milch, die der Muttermilch zumindest in den wichtigen Teilen sehr nahe kommt. Einen vollwertigen Ersatz wird es wohl nie geben.







