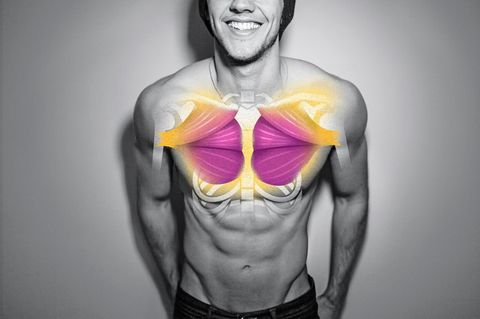"Leukämie? Ich? Niemals, nicht ich." Das sei sein erster Gedanke nach der Diagnose gewesen, sagte Ex-Außenminister Guido Westerwelle im "Spiegel"-Interview. Bei Günther Jauch sprach er nun offen über seine Krebserkrankung. Dass sie den 53-Jährigen gezeichnet hat, war ihm anzusehen. Das Gesicht angeschwollen, die Stimme leicht heiser und verwaschen - es war ein veränderter Guido Westerwelle, den die Zuschauer zu sehen bekamen.
Mit seinem Auftritt will der Politiker anderen Betroffenen Mut machen und über die Erkrankung aufklären.
Was ist Leukämie?
Leukämie ist eine Blutkrankheit, die auch als "Blutkrebs" bezeichnet wird. Vereinfacht gesagt bilden sich bei allen Leukämieformen im Knochenmark vermehrt unreife, nicht funktionsfähige weiße Blutzellen. Diese teilen sich unkontrolliert und gelangen ins Blut und in die Lymphknoten. Auch in den inneren Organen können sie sich ansammeln und diese in ihrer Funktion stören.
Guido Westerwelle ist an der sogenannten akuten myeloischen Leukämie erkrankt. Dabei sind neben den weißen Blutzellen auch die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen betroffen. Bei einer akuten Leukämie muss schnell therapiert werden. Denn anders als die chronische Form des Blutkrebses schreitet diese rasch voran. Innerhalb kurzer Zeit sammeln sich im Blut und Knochenmark große Mengen der kranken Blutkörperchen, was die Bildung gesunder Zellen behindert.
Was sind die Symptome?
Bei einer akuten Leukämie zeigen sich Symptome meist innerhalb weniger Wochen. Die kranken Zellen verdrängen die gesunden, es können weniger funktionierende rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen gebildet werden. Das wirkt sich aus: Die Betroffenen leiden häufig unter Blutarmut, sie sind blass, fühlen sich müde und schlapp. Durch die verminderte Anzahl an weißen Blutkörperchen ist das Immunsystem geschwächt, der Körper ist anfälliger für Fieber und Infekte. Auch Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit können auftreten. Zu den weiteren häufigen Symptomen zählen Blutungen - etwa in der Nase oder im Mund -, geschwollene Lymphknoten sowie schmerzende Gelenke und Knochen. Neurologische Veränderungen wie Kopfschmerzen, Sehstörungen, Übelkeit und Erbrechen oder Gesichtslähmungen können ebenfalls ein Hinweis sein, sie sind allerdings selten.
Wie häufig treten Leukämien auf?
Jährlich erkranken in Deutschland etwa 12.000 Menschen an Leukämie, nur wenige Prozent davon sind Kinder. Verglichen mit anderen Krebserkrankungen - etwa der Prostata oder der Brust - sind Leukämien relativ selten. 2010 lag ihr Anteil an allen Tumorerkrankungen bei etwa zwei Prozent.
Die Leukämieform, unter der Guido Westerwelle leidet, zählt mit jährlich 3,5 Neudiagnosen pro 100.000 Einwohner zu den seltenen Erkrankungen. Allerdings ist sie dem Kompetenznetz Leukämie zufolge die häufigste Form akuter Leukämien in Deutschland. Männer trifft die akute myeloische Leukämie etwas häufiger als Frauen, die Hälfte der Patienten ist älter als 70 Jahre.
Wie wird die Krankheit therapiert?
Rasches Handeln ist nach der Diagnose akute myeloische Leukämie überlebenswichtig, unbehandelt führt sie innerhalb weniger Wochen zum Tod. Die wichtigste Säule der Therapie ist die Chemo. Im Einzelfall kann auch, wie bei Guido Westerwelle geschehen, eine Stammzelltransplantation sinnvoll sein.
Bei einer Chemotherapie bekommt der Patient starke Medikamente, sogenannte Zytostatika, die die Tumorzellen zerstören und am Wachstum hindern sollen. So sorgen sie dafür, dass das Knochenmark wieder gesunde Blutkörperchen bildet. Die Behandlung erfolgt in der Regel in mehreren Intervallen, die Medikamente werden als Infusion oder als Tabletten gegeben.
Da auch gesunde Zellen in ihrer Teilung durch die Medikamente beeinträchtigt werden, kommt es bei einer Chemotherapie häufig zu Nebenwirkungen wie Haarausfall, Erschöpfung, Übelkeit und Erbrechen sowie Entzündungen der Mund- und Darmschleimhaut. Auch eine Abwehrschwäche und Nervenschäden oder -missempfindungen wie ein Kribbeln, Schmerzen oder Taubheitsgefühl in den Fingerspitzen oder den Fußsohlen können auftreten. Um die teilweise starken Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen, werden Patienten unterstützend zur Chemotherapie behandelt - etwa durch die Gabe von Antibiotika, die Infektionen vorbeugen sollen.
Wie funktioniert eine Stammzelltransplantation?
Zunächst müssen dem Spender Stammzellen entnommen werden. Derzeit existieren dafür zwei Verfahren: die sogenannte periphere Stammzellspende und die Knochenmarkspende. Je nach Situation des Patienten kann eine Methode bevorzugt oder ausgeschlossen werden.
Die periphere Entnahme kommt nach Angaben der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in rund 80 Prozent der Fälle zum Einsatz: Der Spender erhält fünf Tage in Folge den Wachstumsfaktor G-CSF verabreicht. Dieser erhöht die Anzahl der Stammzellen im Blut, die im Anschluss direkt aus der Blutbahn entnommen werden können. Die Spende dauert zwischen vier und acht Stunden und findet an ein bis zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt.
Bei der Knochenmarkspende, die in rund 20 Prozent der Fälle angewandt wird, erhält der Spender eine Vollnarkose. Mithilfe einer Punktionsnadel entnehmen Ärzte Knochenmark aus dem Beckenkamm. Die Spende dauert rund eine Stunde.
Die anschließende Transplantation ist recht simpel: Die Stammzellen werden wie eine Blutkonserve als Infusion verabreicht. Im Anschluss wandern die Zellen ins Knochenmark, wo sie anwachsen können und neue, gesunde Blutzellen bilden. Vor der Übertragung müssen allerdings die erkrankten Zellen des Patienten durch eine Chemo- und eventuell eine Strahlentherapie zerstört werden.
Welche Risiken gibt es?
Eine Stammzellübertragung ist ein medizinischer Eingriff, der mit gewissen Risiken behaftet ist - für den Spender, aber auch für den Empfänger.
So kann der Wachstumsfaktor G-CSF, der vor der peripheren Entnahme verabreicht wird, beim Spender grippeähnliche Symptome hervorrufen. Bei der operativen Knochenmarkspende ist eine Vollnarkose erforderlich, deren Risiko sich unter anderem nach dem allgemeinen Gesundheitszustand des Spenders richtet. Im Anschluss an die Entnahme kann es zudem zu Schmerzen kommen, die denen einer Prellung ähneln. In der Regel verschwinden sie jedoch schnell wieder.
Im Vorfeld der Transfusion muss das Immunsystem des Empfängers ausgeschaltet werden, die Patienten sind daher sehr anfällig für Erkrankungen. "Bis das Immunsystem nach der Stammzellspende wieder aufgebaut ist, darf kein Keim an den Patienten kommen", erklärt Klaus Ludwiczak von der DKMS. "Schon eine Erkältung könnte lebensbedrohlich sein." Die Leukämie-Patienten müssten daher auf keimfreien Stationen im Krankenhaus untergebracht werden. Wie lange, ist von Patient zu Patient unterschiedlich. "Es gibt Personen, bei denen sich das Immunsystem bereits nach wenigen Tagen erholt, bei anderen dauert es länger", so der Experte.
Eine allergische Reaktion auf die Transfusion, wie sie Guido Westerwelle offenbar bekommen hat, sei ein ausgesprochen seltenes Ereignis, sagt Ludwiczak.
Warum klingt die Stimme von Guido Westerwelle so anders?
Im Gespräch mit Günther Jauch sprach der ehemalige Außenminister teilweise verwaschen und pausierte lange. Dies sei auf eine "Abstoßungsreaktion" zurückzuführen, so Westerwelle, er leide an einer Entzündung der Mundhöhle.
"Dabei handelt es sich um eine Abwehrreaktion des Körpers auf die Transplantation“, erklärt Klaus Ludwiczak. Eine Entzündung der Mundhöhle könne durchaus häufiger vorkommen. "Sie ist nicht lebensbedrohlich und gut mit Medikamenten zu behandeln“, so der Experte. Ob eine Abstoßungsreaktion auftrete, sei von Patient zu Patient unterschiedlich und richte sich unter anderem nach dem allgemeinen Gesundheitszustand.
Wie ist die Überlebensprognose?
Über individuelle Prognosen lässt sich nur schwer etwas sagen. Alles was es gibt, sind Richtwerte, von denen einzelne Entwicklungen durchaus stark abweichen können. Generell gilt: Die Prognose des Leukämie-Patienten hängt von der Krankheitsform und dem Diagnosealter ab. Die akuten Formen haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Erwachsenenalter eine eher schlechte Prognose. Fünf Jahre nach der Diagnosestellung lebt in etwa noch die Hälfte der Erkrankten. Eine dauerhafte Heilung sei nur selten zu erreichen, etwa nach einer riskanten Stammzelltransplantation.
Mehr Informationen und fachliche Quellen:
Aktualisierung vom 18.03.2016: Dieser Artikel stammt aus unserem Archiv. Guido Westerwelle ist mittlerweile an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung verstorben.