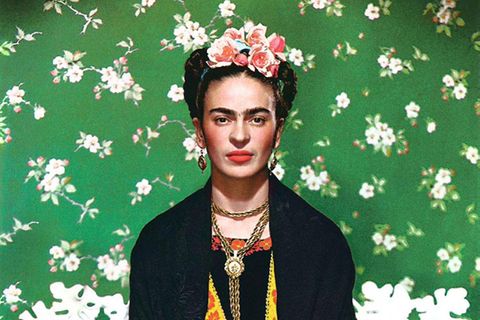Da bricht sich ein Fußballer das Nasenbein und bemerkt es bis zum Abpfiff des Spiels kaum. Es gibt andererseits aber auch starke Schmerzen ohne unmittelbar erkennbare Ursache. Schmerzen sind jedenfalls kein eindeutiges Phänomen. Die Hirnforschung ist mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren dabei, Licht in die komplexen Zusammenhänge des Schmerzempfindens zu bringen.
Gefühl entsteht im Gehirn
Schmerz ist «sicherlich sehr viel eher ein Gefühlszustand als ein rein auf Ursache und Wirkung beruhendes physiologisches Phänomen», schreibt Burkhart Bromm, emeritierter Direktor des Instituts für Physiologie am Universitätklinikum Hamburg-Eppendorf, in der Titelgeschichte des Magazins «Gehirn & Geist» (4/2003, Heidelberg). Da Gefühle im Gehirn entstehen, liegt dort auch der Schlüssel zum besseren Verständnis von Schmerz und zu neuen Therapien, verdeutlicht Bromm, der 1999 mit dem deutschen Schmerzpreis ausgezeichnet wurde.
Beispiel Fakir
Wie Schmerz erlebt wird, lässt sich «nicht nur durch Medikamente, sondern auch ganz bewusst und willentlich beeinflussen, sozusagen kraft unserer Gedanken». Paradebeispiel dafür ist der Fakir: Er fügt sich absichtlich Schmerzen zu, kann aber ihre Dauer und Intensität selbst bestimmen. Durch dieses Gefühl der Kontrolle erhöht sich seine Schmerztoleranz. Zum Erstaunen seiner Zuschauer kann er sein unbequemes Nagelbrettlager eine Weile aushalten. Doch wenn er in einem Moment, in dem er nicht damit rechnet, gepiekst wird, schreit auch er vor Schmerz auf.
Schmerzkontolle
Die Fähigkeit zu seiner Schmerzkontrolle verdankt er dem präfrontalen Cortex (Stirnhirn). Dieser Teil des Gehirns hat sich im Laufe der Evolution des Menschen besonders stark vergrößert. Er ist direkt mit dem Gefühlszentrum, dem limbischen System, verbunden, insbesondere mit dem Cingulum. Die vielleicht wichtigste Aufgabe des Stirnhirns ist, die Bedeutung von Emotionen einzuschätzen und diese gegebenenfalls im Zaum zu halten. Seine Nervenbahnen, und dabei besonders die Verbindungen mit dem Cingulum, lenken die Aufmerksamkeit auch auf Schmerzereignisse und schätzen ab, was sie für den Organismus bedeuten könnten.
Schmerzhemmsystem
«Je nachdem, welche Bedeutung der präfrontale Cortex dem Schmerz beimisst, kann er ihn gegebenenfalls verstärken - oder durch die Aktivierung des Schmerzhemmsystems schwächen», schreibt Bromm. Dass der Fußballspieler mit dem Nasenbeinbruch seine schwere Verletzung kaum bemerkt, liegt schlicht daran, dass sein Gehirn damit beschäftigt ist, Tore zu schießen, und den Schmerz nicht beachtet.
Diese Deutung ist inzwischen auch neurophysiologisch untermauert: Wenn Testpersonen eine anspruchsvolle Rechenaufgabe lösen mussten, ging die bei ihnen durch einen schmerzhaften Laserimpuls hervorgerufene Aktivität im Cingulum deutlich zurück. Auch subjektiv empfanden sie den gleichen Reiz als viel weniger schmerzhaft.
Insgesamt wird deutlich: Der Schmerz ist nicht aus der Welt zu schaffen - ganz abgesehen davon, dass er als körpereigene Alarmanlage lebenswichtig ist. Doch machen die neuen Forschungen und Therapien den weit reichenden Einfluss der Psyche auf das Schmerzerlebnis deutlich und zeigen, wie Patienten ihren Schmerz mit mentalen Kräften besser bewältigen können.
Dazu verweist ein anderer «Gehirn & Geist»-Beitrag auf die Hypnose. «Bei neunzig Prozent aller Personen lässt sich der affektive Anteil der Schmerzen - also die begleitenden quälenden Gefühle - gut reduzieren», sagt Burkhard Peter von der Milton-Erickson- Gesellschaft für Klinische Hypnose (M.E.G.). Ist die Schmerzempfindung auf Grund körperlicher Ursachen sehr hoch, sprächen immerhin noch gut zwei Drittel auf eine Hypnosetherapie an. Das Magazin bemerkt: Mit neurowissenschaftlicher Rückendeckung könnte es dieser Therapieform schon in den nächsten Jahren gelingen, sich einen breiteren Weg in Arztpraxen und Krankenhäuser zu bahnen.
Schmerzen können abtrainiert werden
Über neue Therapiemöglichkeiten auch bei neuropathischen (Nerven-) Schmerzen berichtet das Wissenschaftsmagazin «Rubin» von der Ruhr- Universität Bochum. Bei solchen Schmerzen ist das für die Schmerzleitung zuständige System selbst erkrankt. Es schickt ständig Schmerzimpulse zum Gehirn. Bochumer Forscher zeigen, wie es zu chronischen Nervenschmerzen kommen kann und entwickeln einen neuen Therapieansatz. Er ermöglicht Patienten, sich stufenweise und systematisch ihre Schmerzen abzutrainieren.
Nach Angaben von Christoph Maier, Martin Tegenthoff und Hubert R. Dinse sprechen die Ergebnisse auch dafür, dass sich durch ein noch früheres Training möglicherweise auch eine «zentrale Sensibilisierung» verhindern lässt. Schmerzen müssten dann nicht mehr chronisch werden. «Statt Schmerzreize zu unterdrücken würden Gehirnfunktionen gezielt aktiviert werden.» Schmerzen behandeln hieße dann: Neu fühlen lernen.