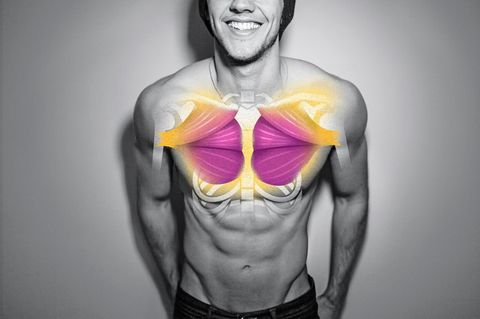"Amaa angai!", sagt Manfred Adelmann. Mund auf. Das kleine Mädchen starrt den ganz in Weiß gekleideten Mann mit Mundschutz, Stirnlampe, runden Augen und merkwürdigem Akzent regungslos an. Adelmann wiederholt seine Bitte und streicht der Fünfjährigen über die Wange. Zögerlich öffnet Tschantsalmaa ihren Mund.
"Wahnsinn", entfährt es Adelmann. Statt weißer Milchzähne ragen aus dem Ober- und Unterkiefer des Mädchens die schwarzbraunen Überreste eines verfaulten Kindergebisses. Diagnose: schwere Karies. Fälle wie dieser gehören seit zwei Wochen zu Adelmanns Alltag. "Du schaust in den Mund und siehst 15 Baustellen. Bei 20 Zähnen", sagt er ungläubig. Mit der Stirnlampe leuchtet er noch einmal in die Mundhöhle des Mädchens, das stocksteif und mit geballten Fäusten vor ihm liegt, als wolle er sich vergewissern, dass er sich nicht vertan hat. "Was soll ich da machen?"
Der 58 Jahre alte Zahnarzt aus Lauf bei Nürnberg sitzt am anderen Ende des eurasischen Kontinents in einem knapp 16 Quadratmeter kleinen Raum der Krankenstation von Bayandelger, einem Provinznest inmitten der weiten mongolischen Steppe. Bis in die Hauptstadt Ulaanbaatar sind es rund 100 Kilometer, die sich anfühlen als wären es 1000. Von der Wand bröckelt die Farbe, auf den Fensterbänken und zwei Tischen türmen sich Behandlungsmaterialien und Instrumente aus Deutschland. Dazwischen zwei zusammenklappbare Behandlungsstühle, Rollhocker sowie zwei mobile Dentaleinheiten mit Bohrer, Sauger und einer UV-Lampe zum Aushärten von Füllungen.

In dieser improvisierten Zahnarztpraxis arbeiten neben Adelmann noch Zahnärztin Heike Bollmann, Medizinstudent Pascal Possiel und Helferin Valeria Cuttitta, dazu Übersetzer Purev Sukh-Ochir, der eigentlich einen Lebensmittelladen in der Hauptstadt führt. Die Gruppe ist Teil eines Hilfseinsatzes der deutschen Organisation "Zahnärzte ohne Grenzen", die seit mehr als zehn Jahren die Bevölkerung im mongolischen Hinterland versorgt – Hilfe, die hier dringend benötigt wird.
Nur Grönland ist dünner besiedelt als die Mongolei. Auf einer Fläche mehr als viermal so groß wie Deutschland leben pro Quadratkilometer im Schnitt nicht einmal zwei Menschen. Schon allein die geografische Dimension gestaltet die medizinische Versorgung der Menschen außerhalb der Hauptstadt schwierig. Hinzu kommt: Die Wirtschaft des an Bodenschätzen reichen Landes steckt in einer Krise. Bei den Ausgaben für den Gesundheitssektor kommt das Land im weltweiten Vergleich nicht über einen Platz im hinteren Viertel hinaus. Der für Zahngesundheit aufgewendete Anteil dieses Budgets liegt mit 0,5 Prozent weit unter dem globalen Durchschnitt.
Die Globalisierung bringt den Zucker
Die Folgen sehen die weit gereisten Zahnärzte in den Mündern ihrer Patienten. "Ein kariesfreies Kind ist die absolute Ausnahme", sagt Heike Bollmann, 59, und blickt eindringlich über den Rand ihrer Schutzbrille. Mindestens die Hälfte der vor der Tür wartenden Patienten ist jünger als zehn Jahre, die meisten haben Zahnschmerzen. Schon vor dem Frühstück standen die Namen von 80 Bewohnern des Dorfes und Nomaden aus dem Umland auf der Liste für den heutigen Behandlungstag. Einige warteten bereits um 5.30 Uhr vor der Klinik. Der Ansturm ist groß, denn ein einheimischer Zahnarzt kommt nur alle drei Jahre nach Bayandelger. Für zwei Tage.
Der Mann, der den Zustand der Zahngesundheit in der Mongolei wohl am besten kennt, ist Bazar Amarsaikhan, Präsident der Mongolian Dental Association (MDA). Vor seinem Büro in Ulaanbaatar hupen Autofahrer vergebens gegen den die Hauptstadt lähmenden Verkehr an. "94 Prozent der Fünf- bis Sechsjährigen haben Karies", sagt der Professor für Zahnmedizin. Bei Kindern mit bleibenden Zähnen seien es 84 Prozent.

Schuld am desaströsen Zustand der jungen Gebisse sei vor allem der extrem gestiegene Zuckerkonsum der Mongolen, erklärt er. Selbst in den entlegensten mongolischen Sums, den Bezirken innerhalb der 21 Provinzen, füllen knallbunte Süßigkeiten – darunter viele deutsche Marken – die ansonsten spärlich bestückten Regale der Lebensmittelläden. Ein besorgniserregender Trend, den die Mongolei laut zahnärztlichem Weltverband FDI mit vielen aufstrebenden Entwicklungsländern teilt. Die Globalisierung schenkt den Menschen das süße Luxusgut – aber ohne Zahnbürsten mitzuschicken. Dazu kommen ein nur zögerlich erwachendes Bewusstsein für Mundhygiene und Unzulänglichkeiten im Gesundheitssystem.
"Von den 1400 praktizierenden Zahnärzten in der Mongolei arbeiten mehr als 95 Prozent in der Stadt", sagt Amarsaikhan. Stadt, das heißt in der Mongolei in erster Linie Ulaanbaatar. Knapp die Hälfte der drei Millionen Mongolen lebt bereits in der vom andauernden Smog grau gewordenen Hauptstadt, und jedes Jahr werden es mehr. Hier ist das Verhältnis von Zahnärzten zur Einwohnerzahl besser als in manchen Regionen Deutschlands. Aber in den Provinzen kommen auf einen Zahnarzt mitunter 13.000 Patienten. Mit der Größe des Landes allein lässt sich dieses Ungleichgewicht nicht erklären. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus nutzten viele mongolische Ärzte die Chance, nur noch lukrative Behandlungen für Privatpatienten anzubieten. Die hohen Zuzahlungen für nicht von der Versicherung abgedeckte Behandlungen können sich nur die reichsten 20 Prozent der Mongolen leisten. "Wir müssen ein dichteres Netz von Zahnärzten aufbauen, aber vor allem stärker an das soziale Gewissen der Privatärzte appellieren", sagt der Funktionär. "Demokratie bedeutet nicht nur Freiheit, sondern auch Verantwortung."
Improvisation bei der Behandlung
"Den Nomaden hilft niemand", schimpft Tuul Macher, 53. Die Geschäftsführerin von "Zahnärzte ohne Grenzen" ist gebürtige Mongolin und arbeitete 15 Jahre lang als eine von nur zwei Chirurgen in der Zentralprovinz Töv, einem Gebiet größer als Bayern, ehe sie 2004 ihren Mann und Gründer der Stiftung kennenlernte. "Ich möchte meinem Heimatland helfen", erklärt sie.
Dafür belädt sie zwei Geländewagen und fährt jede Woche alle Einsatzorte ab, um die Helfer mit Hilfsgütern aus Deutschland zu versorgen: Zahnpastatuben, Latexhandschuhe, sterile Tamponaden, Füllmaterial, Betäubungsmittel und vieles mehr. In früheren Jahren kam es vor, dass den Ärzten das Anästhetikum ausging und sie schmerzhafte Eingriffe ohne Betäubung vornehmen mussten. Das soll nicht wieder vorkommen.
Die Autos verlassen das Stadtgebiet westwärts. Mit jedem Kilometer wird die Besiedlung dünner, das Land weiter. Nach etwa 100 Kilometern biegt der Fahrer rechts die Böschung hinab auf eine von tiefen Schlaglöchern gesäumte Lehmpiste. Fernab der ausgefahrenen Reifenspuren stehen vereinzelt Jurten, die runden Zelte der Nomaden. Schaf- oder Ziegenherden ziehen durch die Steppe. Irgendwann tauchen ungewohnte Farbkleckse im ewigen Grün auf: Zaamar. Das Dorf ist geprägt von farbenfroher, aber in die Jahre gekommener sozialistischer Architektur, dazu Holzhäuser mit Dächern in knalligem Orange oder Grün.

Die Wagen halten vor der Krankenstation, die, wie alles im Ort, schon bessere Zeiten erlebt hat. Daneben arbeiten die deutschen Zahnärzte in einem flachen Backsteinbau, vor dem gut ein Dutzend Mongolen in der Sonne auf ihre Behandlung wartet. Durch einen engen Flur und ein Spalier aus geschwollenen Wangen und neugierigen Blicken gelangt man in den Behandlungsraum. Laminatboden, Regale und abgehängte Deckenplatten mit Leuchtstoffröhren erinnern eher an ein Büro als an eine Praxis. Auch sonst hat der improvisierte Arbeitsplatz der Zahnärzte Rebecca Kelm und Benjamin Roth sowie ihrer Helferinnen wenig mit ihrem Alltag in Deutschland zu tun.
Roth, 31, mit Armen kräftig wie Oberschenkel, schnitzt gerade ein Streichholz zurecht. Weil ihm Keile fehlen, die beim Bohren in den Zahnzwischenräumen die Zähne auseinanderdrücken, steckt er das Holzstäbchen ins Gebiss seines Patienten. "Man muss sich nur zu helfen wissen", sagt der hörbar aus dem Rheinland stammende Roth, ehe er den Bohrer ansetzt und das Brummen und Zischen des Kompressors in der mobilen Dentaleinheit jede weitere Unterhaltung übertönt.
Improvisieren muss auch Kollegin Kelm nebenan. "Die ersten Tage haben wir nach deutschen Standards jedes Instrument nur einmal benutzt", sagt die 34-Jährige und öffnet den Deckel einer Plastiktonne hinter dem Behandlungsstuhl. "Dann kam es in den Desinfektionsbottich." In farbloser Desinfektionslösung liegen silbrig schimmernde Spiegel, Sonden und Zangen, an denen Blut- und Speichelreste kleben. "Nachmittags standen wir dann ohne passende Instrumente da und haben die Zähne nicht mehr rausgekriegt." Die Krankenstation von Zaamar kommt mit dem Sterilisieren kaum hinterher. Und so zieht Kelm einen gerade noch benutzten Hebel ein paar Mal durch die Flüssigkeit und tupft ihn trocken. Wischdesinfektion. "Das deutsche Gesundheitsamt würde uns einen Vogel zeigen", ruft Kollege Roth herüber.
Zähne ziehen im Akkord
Doch nicht einmal diese Notlösung war in der Vergangenheit hygienischer Standard in mongolischen Arztpraxen. So bestand für Patienten lange Zeit die Gefahr, eine Zahnarztpraxis mit Zahnschmerzen zu betreten und sie mit Hepatitis zu verlassen. Mangelnde Desinfektion und Mehrfachnutzung von Spritzen führten zu einer der weltweit höchsten Infektionsraten. Jeder fünfte Mongole trägt mindestens einen der Virenstämme B und C im Körper – und nur ein Drittel der Infizierten weiß davon. Auch wenn die Zahl der Neuansteckungen zurückgeht: Leberkrebs und andere Folgen einer unbehandelten Hepatitis-Infektion sind die zweithäufigste Todesursache im Land.
Spendenaufruf
Die Organisation "Zahnärzte ohne Grenzen" freut sich über freiwillige Helfer (Zahnärzte und Zahnmedizinische Fachangestellte) für Einsätze in der Mongolei, in Namibia, Togo, Sambia oder auf den Kapverden. Die Stiftung ist auf Sachspenden von Behandlungsmaterialien angewiesen. Außerdem sammelt sie Winterkleidung für Kinder. Weitere Infos: www.dwlf.org
Viel Zeit, über ihre Arbeitsbedingungen nachzudenken, haben die 23 Zahnärzte und ihre Helfer nicht. Sie arbeiten im Akkord, behandeln zwischen 50 und 80 Patienten täglich, insgesamt fast 9000. Die Anamnese beschränkt sich auf die Frage des Dolmetschers, wo es weh tut, dann folgen meist Spritze, Zange, Tupfer, Draufbeißen, der Nächste bitte. Die Deutschen ziehen Zahn um Zahn. Auf den Strichlisten, die in jedem Behandlungsraum aushängen, um die erbrachten Einzelleistungen zu dokumentieren, reicht der Platz bei "Extraktionen" oft kaum aus. Mehr als 6000 sind es am Ende des sechswöchigen Einsatzes.
"Alles andere macht oft keinen Sinn", erklärt Roth in einer kurzen Verschnaufpause. Aufwändige Wurzelbehandlungen fallen weg, weil es kein Röntgengerät gibt und mehrere Sitzungen nötig wären. Füllungen sind nur bei kleinen Löchern angebracht. Bei schwerer Karies wäre Prothetik nötig, aber die ist zu aufwendig. So lindern die Deutschen in erster Linie Schmerzen und packen dafür das Übel an der sprichwörtlichen Wurzel.
Für die dringend benötigte Aufklärungsarbeit fehlt in den meisten Einsatzorten die Zeit. Immerhin: Die Patienten bekommen eine Tube Zahnpasta samt Zahnbürste in die Hand gedrückt, dazu einen Zettel mit einer Anleitung zum richtigen Zähneputzen.
Dankbare Patienten
In Bayandelger hat Manfred Adelmann entschieden, nichts bei dem kleinen Mädchen mit den verfaulten Zähnen zu unternehmen. "Die Mutter wollte, dass ich alle Zähne rausnehme, aber sie war zu jung und hatte angeblich keine Schmerzen." Er zieht den Mundschutz herunter, formt mit den Fingern seiner linken Hand einen Tunnel und erklärt: "Die bleibenden Zähne brauchen einen Kanal, um gerade aus dem Kiefer zu wachsen. Werden die Milchzähne zu früh gezogen, schließen sich die Kanäle, und die bleibenden Zähne schießen kreuz und quer aus dem Zahnfleisch." Ohne kieferorthopädische Behandlung keine Option.

Nach dem Mädchen betritt eine Nomadenfamilie den Raum. Vater Nasanbat Daribazar, 40, trägt Deel, ein traditionelles Gewand aus schwerem dunkelblauen Stoff und gelbem Hüftbund. Helferin Cuttitta zieht hastig den Mundschutz über die Nase. "Pferd", vermutet Heike Bollmann, als sie sich über den Patienten beugt und seine Mundhöhle ausleuchtet. Der Viehzüchter hat entzündete Wurzelreste, doch weil er heute noch seine Fohlen einfangen muss, schlägt Bollmann vor, er solle morgen wiederkommen.
Auf dem Stuhl nebenan muss bei seiner Frau Batchimeg, 31, der 3-6er weichen. Manfred Adelmann überlässt den Backenzahn unten links Pascal Possiel. Der Zahnmedizinstudent greift zum Hebel, aber diesmal heißt es nicht: Ruckzuck raus. Der Zahn sitzt fest. Ein Röntgenbild wäre jetzt hilfreich. Stattdessen packt der 29-Jährige mit der "Russenzange" zu, biegt Kiefer und Kopf der Patientin nach links und rechts. Doch auch das besonders gebogene Instrument kann nichts ausrichten. "Er wackelt, aber nach oben ziehen geht nicht", sagt Possiel. "Der hat bestimmt eine hundsgemeine Wurzel", vermutet Adelmann während der Schlauch in seiner Hand glucksend Blut und Speichel aus dem Rachen der Frau saugt. Am Ende hilft nur die Fräse, die den Zahn mit den wie O-Beinen gekrümmten Wurzeln zerteilt. Die Anspannung löst sich, in Possiels Gesicht und in den tief ins Kunstleder des Behandlungsstuhls gegrabenen Händen seiner Patientin. "Im Studium lernst du so etwas nur in der Theorie", sagt Possiel.
Batchimeg, ihr Mann und ihr neunjähriger Sohn fahren in ihrem klapprigen Kleintransporter zurück in die Jurte. Drinnen reicht Daribazar zwischen spartanischer, aber kunstvoll und farbenfroh verzierter Einrichtung Schalen mit "Airag", vergorene, säuerlich schmeckende Stutenmilch. Dazu gibt es "Boov", frittierten Teig, und gebratene Butter mit Zucker. Und Wodka. Auch seine Frau, die auf Anraten der Ärzte zwei Stunden nichts essen soll, nimmt einen kräftigen Schluck. "Ist gut nach dem Besuch beim Zahnarzt", sagt Daribazar mit gerecktem Daumen und lacht. Er ist dankbar für die Arbeit der deutschen Helfer. "Beim mongolischen Zahnarzt ist die Füllung nach einem Monat wieder rausgefallen", erzählt er. Dann muss er los, die Fohlen einfangen. Durch die Tür der Jurte betritt er die grün-blaue Unendlichkeit seiner Heimat. Am Türrahmen hängt ein Metallkörbchen mit Zahnpasta und Zahnbürsten darin.
Die Recherche wurde vom "Global Health Journalism Grants Programme for Germany" des European Journalism Center unterstützt. Die Reportage ist bereits im Oktober 2018 in "Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben" erschienen.