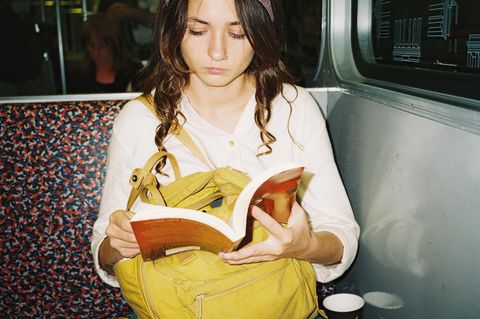Zazie kann mit Dieos Leben nicht viel anfangen: Die große Schwester hat drei Kinder, Lastenrad, Altbauwohnung und einen Mann, der ein Finanz-Start-up betreibt. Ein bürgerliches Idyll im Frankfurter Nordend. Und Dieo? Die findet, Zazie macht es sich zu schwer mit ihrer manischen Wokeness. Überall sieht sie Ungerechtigkeit, Kapitalismus, Patriarchat. Nicht mal an Weihnachten kann sie abschalten.
Yandé Seck beobachtet und seziert die Welt der schwarzen Schwestern. Sie erzählt, wie Dieo, Therapeutin, neue Möbel für ihre Praxis sucht, im Stil von "Woody Allen meets Mary Poppins: Das Flair einer New Yorker Praxis, aber die Gemütlichkeit britischer Kinderzimmer". An anderer Stelle erzählt sie, wie Zazie während der Pandemie ein "afro-diasporisches FLINTA*-Netzwerk" gründet. Klingt akademisch, aber eigentlich will Zazie nur in ihrer Küche zu Lizzo tanzen, Cookies backen und "Love Island" schauen.
Die Figuren im Roman wachsen dem Leser schnell ans Herz
Bei allen Eitelkeiten wachsen der Leserin die überzeichneten Figuren schnell ans Herz. Auch Ulrike, die weiße Mutter, die ihre Feiertage in einem Ayurveda-Hotel auf Sri Lanka verbringt, das sie unbeirrt "Ceylon" nennt. Sowie all die verschrobenen Karl-Georgs und Giselas, welche die Welt der Schwestern bevölkern. Sogar Simon mag man, Dieos Ehemann, aus dessen Perspektive Passagen des Romans erzählt sind. "Mich in ihn hineinzuversetzen war ein Abenteuer", erklärt Seck, "aber eigentlich waren mir alle drei beim Schreiben nah."
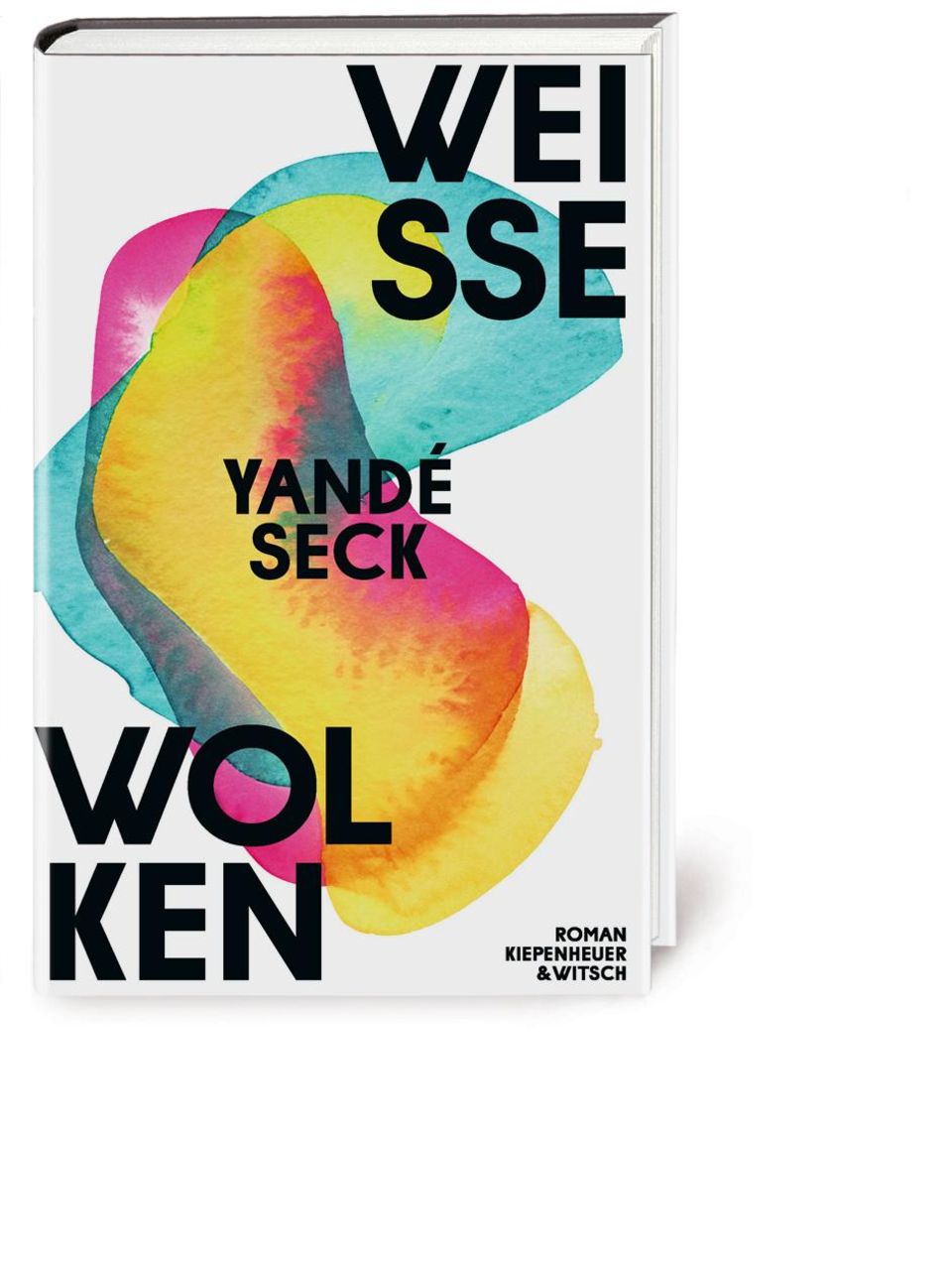
Die Autorin sucht die "Weißen Wolken", so der Buchtitel, ihrer Figuren. Das sind die kleinen Verletzungen der Nägel, die sich als weiße Flecken zeigen. "Es sind die Spuren, die unsere sogenannte Identität bei uns hinterlässt", erklärt Zazie. Vor lauter Alltag und Beziehungsdramen, kranken Kindern und kleinen Lebenskrisen dauert es zwei Drittel des Buches, bis die beiden Schwestern zu der Reise aufbrechen, die im Klappentext versprochen wird. Als der Vater stirbt, machen sie sich auf in sein Heimatland, den Senegal. Und lernen, dass sie noch viel mehr ausmacht als nur all die urbanen Belanglosigkeiten.
Der Roman ist erzählt wie eine Netflix-Serie aus dem Großstadtalltag, pointiert und gegenwärtig, voll schöner Dialoge und kluger Beobachtungen. Wer nicht in einer Großstadt lebt, an dem zieht vielleicht die eine oder andere Pointe über Wollwalk-Overalls und Concept-Stores vorüber. Witzig ist das alles aber trotzdem.