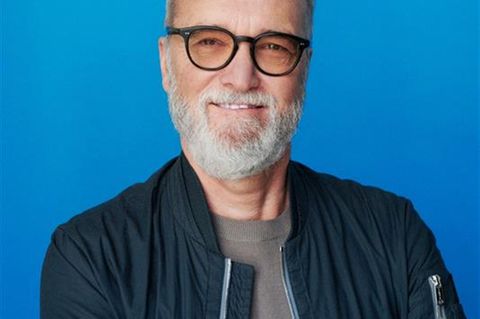Sebastian Haffner wollte nicht Journalist werden. Auch nicht Historiker. Schon gar nicht Lehrer, wie so ziemlich jeder in seiner Familie. Sein Vater war Schuldirektor und ein angesehener Reformpädagoge. Sebastian Haffner ist Journalist geworden, auch Historiker, kein forschender zwar, sondern ein erzählender, ein lehrender. Vielleicht der bekannteste Geschichtslehrer Deutschlands.
Aber wie wird so einer, was er nicht werden wollte? Als es dem gelernten Juristen Sebastian Haffner im August 1938 gelungen war, mit einem Rechercheauftrag Hitlerdeutschland gen England zu verlassen, war er über Nacht de facto berufslos. Englisch konnte er kaum. Das Land seiner Wahl wäre Frankreich gewesen, aber was hätte es ihm genutzt? In England war er sicher, und er begann zu schreiben, auf deutsch. In Berlin hatte Haffner einige Jahre als Redakteur einer Modezeitschrift gearbeitet und dort sehr witzige und hintergründige Feuilletons geschrieben.
"Sind die Deutschen verrückt geworden?"
Dem ständig am Rande des materiellen Abgrundes balancierenden Verleger Frederic Warberg bot er ein Exposé und einige Kapitel an: Die "Geschichte eines Deutschen", ein ziemliches Wagnis. "Dieser Text war mein erster Einfall. Ich überlegte, was kannst Du denn eigentlich schreiben? Und es fiel mir auch auf, dass man in England damit vielleicht ein Publikum finden konnte, denn das Verhältnis zu Deutschland mit dem in der Luft liegenden Krieg war ja da, und in vielen Kreisen fragte man sich, was ist dieses Deutschland eigentlich, wir haben es doch gekannt. Sind die Deutschen verrückt geworden, sind sie wirklich alle verrückt geworden?" Keine schlechte Idee. Das Wagnis bestand darin, dass er versuchte, die jüngste Geschichte Deutschlands anhand der Geschichte eines jungen Deutschen zu beschreiben - seiner eigenen.
Der Verleger war begeistert und bot Haffner einen Buchvertrag. "Haffner wusste nicht, in welcher verzweifelten Notlage sich der Verlag befand, und ich traute mich nicht, es ihm zu erzählen. Aber ich erinnere mich an seinen Entwurf als den brillantesten, der mir jemals vorgelegen hat." Haffner war glücklich und sah zum ersten Mal eine "wenn auch noch so kleine Grundlage, auf der man irgendwie zu existieren anfangen konnte." Er erhielt als Vorschuss zwei Pfund Sterling die Woche.
Erster Einfall erschien posthum
Doch nach wenigen Monaten, bei Kriegsbeginn, bekam Haffner Skrupel. Unmöglich könne er weiterhin etwas dermaßen Persönliches schreiben. Er legte seine Erinnerungen beiseite und begann eine Analyse der deutschen Gesellschaft, die er ziemlich phantasielos "Deutschland, ein Querschnitt" überschrieb. Von Warberg stammte der spätere Titel "Germany: Jekyll and Hyde". Haffners "erster Einfall" im englischen Exil, die "Geschichte eines Deutschen", erschien erst nach seinem Tod 1999. Allerdings hatte Haffner 1983 einige Seiten dieses Manuskripts aus der untersten Schublade seines Schreibtischs hervorgeholt und dem stern anlässlich der 50. Wiederkehr des Schicksalsjahrs 1933 angeboten. Es beschreibt die Umstände der Flucht eines jüdischen Freundes (stern 14/1983).
Haffner gehört nicht zu der Gruppe intellektueller Emigranten, über die Adorno schrieb, dass sie ohne alle Ausnahme beschädigt seien und gut daran täten, dies zu erkennen. Für Haffner war das Exil ein Glücksfall. Es schuf ihn, was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass er sich im Exil für sein erstes Buch, eben "Germany: Jekyll and Hyde", das Pseudonym zulegte. Niemand kennt Raimund Pretzel, so Haffners bürgerlicher Name.
Der Deutsche mimte den Engländer
Als Korrespondent des "Observer", bei dem er als "feindlicher Ausländer" im Krieg eine bemerkenswerte Karriere machte - in einer Redaktion vereint mit Isaac Deutscher, George Orwell und Richard Löwenthal - kehrte er 1954 nach Deutschland zurück. Im Frühschoppen Werner Höfers mimte er den Engländer, in der "Welt" den kalten Krieger.
Der Bau der Berliner Mauer - "man mauert nicht ein, was man erobern will" - bedeutete für ihn das Ende der akuten und bedrohlichen Nachkriegszeit. Die Spiegelaffäre bald darauf ließ bei ihm alle Alarmglocken schrillen. Sebastian Haffner erfand sich ein zweites Mal: Außenpolitisch begann er, im stern, einer Politik der Verständigung vorzuarbeiten, innenpolitisch ging er in die Konfrontation mit den konservativen Kräften. Hinter der Nacht-und-Nebel-Aktion gegen den "Spiegel" und der Verhaftung Rudolf Augsteins vermutete Haffner ein faschistisches Potential - und das in dem Land, in das er gerade erst zurückgekehrt war. Aus der konservativen Richtung schlug ihm nach diesem doppelten Linksruck blanker Hass entgegen.
Gesellschaftskritiker und Widerstandskämpfer
Hunderte Kolumnen im stern ("Sebastian Haffners Meinung") zeigen Haffner als Gesellschaftskritiker, als Widerstandskämpfer und als Vorbereiter der APO sowie der später so genannten Ostpolitik der sozialliberalen Koalition. Er sehnte nun den politischen Wechsel herbei; ohne das Gesellenstück einer friedlichen Machtübergabe an die Opposition war eine Demokratie in seinen Augen nicht vertrauenswürdig. Und hat nicht das sture Festhalten der CDU in den 60er Jahren an der einmal eroberten Macht überhaupt erst zur politischen Eruption der späten 60er Jahre geführt?
Nie war Haffner besser, provokanter, aufklärerischer, manchmal auch schriller, als in diesen Jahren. Seine wöchentliche Kolumne im stern nannte er rückblickend einen "Knallfrosch", den er jede Woche mit Vergnügen anzündete. Nebenbei fing er an, den Deutschen die Geschichte ihres Landes näher zu bringen, vor allem die Jahrzehnte vor der Hitlerzeit. In mehreren umfangreichen Serien, die später auch als Buch erschienen sind, schrieb er Darstellungen, die zum Erhellendsten und zugleich Lesbarsten gehören, was man über die grundlegenden Weichenstellungen des Jahrhunderts - im und nach dem Ersten Weltkrieg - lesen kann. In den sechziger wurde Haffner nach und nach zum Historiker - im stern.
"Er musste damals nicht regieren"
In "Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches" analysiert Haffner den politischen und militärischen Irrweg des kaiserlichen Deutschland im Krieg; in "Der Teufelspakt" beschreibt Haffner - vor 40 Jahren! - die Förderung und Finanzierung der russischen Revolution durch das Deutsche Reich, was in der sowjetischen Botschaft in Bonn Tobsuchtsanfälle auslöste. Seine Serie über das Versagen der SPD in der Revolution 1918 ("Der große Verrat") veranlasste Willy Brandt zu der Bemerkung, dass Haffner das leicht so habe schreiben können, schließlich "musste er damals nicht regieren".
Haffners größter Erfolg zu Lebzeiten waren die "Anmerkungen zu Hitler", ein Buch, in dem Haffner den Deutschen die verhängnisvolle Affäre mit Hitler nachsieht, fast verzeiht. Jedenfalls ist es dieser Aspekt, der in der Rückschau von diesem schmalen Büchlein übrig geblieben zu sein scheint. Und wer - aus Haffners Generation - an dieser Affäre teilgenommen hatte, erhielte nicht gerne im Nachhinein die Absolution? Es ist vielleicht kein Zufall, dass Haffner für genau dieses Buch spät zum Historiker geadelt wurde, nachdem er bereits Jahrzehnte seines Lebens als Journalist, Historiker und als eine Art Volkshochschullehrer für Geschichte tätig gewesen war.