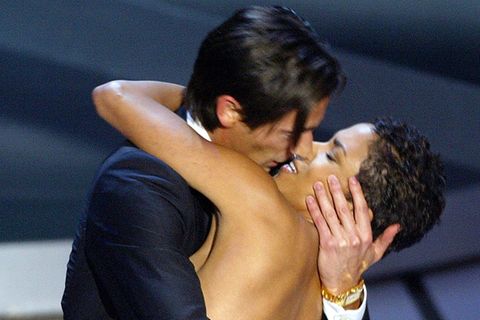Eine Premiere, Moskau, ein nasskalter Abend, die schwarzen Limousinen parken vor dem Gebäude am Roten Platz, das einst von Stalin errichtet wurde. Heute beherbergt es ein Luxushotel mit angeschlossener Luxuseinkaufspassage, darin ein Luxuskinokomplex. Hier findet an diesem Abend die russische Premiere eines, nun ja, sehr russischen Filmes statt. Ein hochgelobter Film, der gute Chancen auf einen Oscar hat: "Leviathan".
Die russische Premiere wäre eine durchaus patriotische Gelegenheit gewesen, die Errungenschaften des neuen russischen Films zu feiern und Werbung für das Russland zu machen, das sich nun so abwendet vom angeblich so dekadenten Westen. Man hätte VIP's erwarten können, vielleicht auch den Kulturminister - schließlich wurde dieser Film öffentlich gefördert. Fehlanzeige. Ein paar Hundert Gäste sind zur Premiere gekommen, kaum Offizielle, schon vor Mitternacht ist die Party vorbei, und das ist selbst im krisengeschüttelten Moskau dieser Tage eher ungewöhnlich.
Automechaniker versus korrupter Bürgermeister
Es ist, als ob da ein Film totgeschwiegen werden sollte. Das aber gelingt nicht. Denn "Leviathan" ist im Westen schon jetzt preisgekrönt wie kein anderer russischer Film der vergangenen Jahrzehnte: Eine "Goldene Palme" für das beste Drehbuch in Cannes; bester Film des "London Film Festival", dann auch noch ein Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film, der erste für einen russischen Film seit "Krieg und Frieden" 1969. Und jetzt stehen die Chancen nicht schlecht für die Filmtrophäe schlechthin: Den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.
"Leviathan". Gedreht im 957 Einwohner grossen Teriberka, diesem winzigen, verlorenen Ort im arktischen Norden Russlands, auch dort überleben Menschen die Tage, irgendwie.
Nikolaj, der erfolglose Automechaniker, ist ein Hiob in diesem Russland; er will um sein Haus kämpfen, aber dieses Haus steht nun mal auf einem Grundstück, auf das es der korrupte Bürgermeister abgesehen hat, und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Ein Mann, er ist kein Held, kämpft um sein Recht gegen die ruchlose Gesetzeslosigkeit, und jeder weiss, es wird vergebens sein.
"Insekten, die in Scheisse ertrinken werden"
Der bullige Bürgermeister thront in seinem Büro unter dem Porträt des russischen Präsidenten Putin, seine Bürger für ihn nur "Insekten, die in der Scheisse ertrinken werden", und die orthodoxe Kirche unterstützt sein kriminelles Handeln. Ein Freund ist niemals ein Freund, ein Nachbar wird zum Verräter, alles ertrinkt in Wodka, so viel Wodka, auch der Wochenendausflug, bei dem Männer mit Gewehren auf die vergilbten Portraits ehemaliger Parteichefs zielen, auch Boris Jelzin ist im Angebot. Und alles kommt noch viel schlimmer in diesem bedrückenden Film mit seinen langsamen Bildern und den mächtigen Wellen der Barentssee, die gegen die Felsen schlagen.
Einige Bewohner des Drehortes Teriberka sollen nach Aufführung des Films im örtlichen Verwaltungszentrum gar gesagt haben: Unser Leben ist in Wahrheit noch schlimmer.
Unerbittlich. Erbarmungslos. Es gibt keinen Ausweg. Nirgends.
Regisseur zur Persona-non-grata erklärt
All das ist ja wahr, die Korruption, die Gesetzeslosigkeit die unheilige Allianz zwischen Staat und Kirche, jeden Tag erleben es die Menschen in Putins Russland - und so musste es natürlich Kritik an diesem angeblich "unpatriotischen", gar "bösen" Werk hageln.
Der russische Kulturminister Wladimir Medinskij sprach von Filmen, "die auf unsere Autoritäten spucken und unsere Existenz nur als vollkommene Ausweglosigkeit beschreiben". So etwas sollte fortan nicht durch Steuergelder finanziert werden. Er sagte: "Habe ich etwas Russisches in diesem Film wiedererkannt? Nein, ganz egal, wieviel Wodka getrunken wird. Wen oder was liebt der Regisseur eigentlich? Etwa nur Ruhm und rote Teppiche und kleine Statuen?"
Die Kinos im Kreis Pskow sollen mündlich von höherer Stelle den Rat bekommen haben, den Film nicht zu zeigen: Er werde ja zu wenig Zuschauer finden. Im sibirischen Omsk wurde der Regisseur kurzzeitig zur Persona-non-grata erklärt; und in Samara strengten die Behörden ein Steuerprüfungsverfahren gegen den Direktor des örtlichen Theaters an: Denn dieser Walerij Grischko hatte gewagt, die Rolle des bösen Erzpriesters im Film zu übernehmen.
Lokalpolitiker beschuldigten Grischko des Vaterlandsverrates. Und der fühlte sich an Zeiten erinnert, die wohl noch gar nicht so lange her sind: "So muss es gewesen sein, als Paternaks 'Doktor Schiwago' oder später Solschenizyns 'Archipel Gulag' veröffentlicht wurden."
Thomas Hobbes ist allgegenwärtig
Der staatsloyale Kommentator Sergej Markow verstieg sich gar: Leviathan sei ein "Film des neuen Kalten Krieges des Westens gegen Russland", gar eine "antirussische Auftragsarbeit". Der Regisseur solle auf dem Roten Platz auf die Knie gehen und sich entschuldigen.
Sicher beschreibe sein Film auch Wahrheiten des russischen Lebens, sagt Regisseur Andrej Swjaginzew, aber viel mehr als das. Die Idee sei geboren, als er 2008 von der tragischen Geschichte des Amerikaners John Heemeyer aus dem Bundesstaat Colorado gehört habe, der aus Verzweiflung über einen verlorenen Grundstücksstreit das örtliche Bürgermeisteramt sowie das Haus des Bürgermeisters mit einem Bulldozer niederwalzte, bevor er Selbstmord beging.
"Leviathan" trage eine größere Wahrheit: Mit dem Titel beziehe er sich auf das Werk von Thomas Hobbes, des englischen Staatsrechtlers, der einst den "Menschen als des Menschen Wolf" bezeichnete und den allmächtig-fürsorglichen Staat propagierte, dem sich die Menschen unterwerfen würden. So sei es in Russland, aber auch anderswo: "Es scheint, als erhielten die Menschen Sicherheit nur von den Strukturen der Macht. Sonst scheint jeder auf sich allein gestellt, einsam, in einem ewigen Kampf um die kleinsten Dinge des Lebens. Für den vermeintlichen Schutz durch den Staat aber müssen die Menschen ihre Freiheit hergeben. Das aber ist ein Pakt mit dem Teufel."
Was, wenn "Leviathan" den Oscar bekommt?
So sei es in Russland und anderswo, sagt Swjaginzew. Ihn stimmt optimistisch, dass "Leviathan" doch auch in Russland durchaus wohlwollende Kritiken bekam, nun doch in 650 russischen Kinos läuft und Millionen Mal illegal gestreamt wurde. Immer noch leben Menschen in Russland, seiner Heimat, die sich ihre Freiheit nehmen. Oder zumindest ein Stückchen davon.
Das russische Kulturministerium allerdings will in Zukunft vorbeugend tätig werden: Nach einem Gesetzesentwurf soll fortan die Verbreitung aller Filme verboten werden, "die nationale Kultur schmähen, die nationale Einheit bedrohen und die Grundlagen unserer Verfassung unterminieren."
Stellt sich dem Kulturminister und all den staatstreuen Medien in den folgenden Tagen nur ein Problem: Was tun, wenn "Leviathan" den Oscar bekommt? Wie dann aus einem "Werk des Bösen" einen Film zu Ruhme Russlands machen?
Man darf zuversichtlich sein: Da sind Propaganda-Profis am Werk. Es wird schon gelingen.
"Leviathan" ist ab dem 12. März in den deutschen Kinos zu sehen.