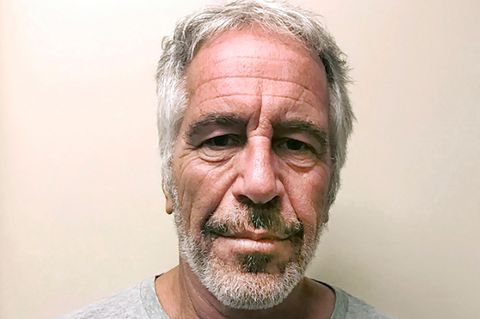Nackt steht er auf einem miesen, kleinen Klappstuhl: Ai Weiwei, der bekannteste Chinese der Kunstwelt. Den Pimmel nach hinten zwischen die Beine geklemmt, den Blick schamhaft nach unten gerichtet, daneben sein zerwühltes Bett. Es ist das selbstironische Foto-Porträt eines Rebellen, der noch nicht so recht weiß, in welche Richtung das Leben ihn treiben wird.
26 Jahre alt war Ai Weiwei damals, zart und schmal. Mit einem Stipendium war er 1983 nach New York gereist, und wie Hunderte von Künstlern träumte er davon, groß rauszukommen. Hier, so hoffte er, könnte der Sprung an die Spitze gelingen. Schließlich waren zu dieser Zeit alle in New York, die er bewunderte: Andy Warhol und Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg und Jasper Johns.
Aber so einfach, wie er hoffte, lief es nicht. Ai Weiwei sprach nur schlecht Englisch, wohnte in einem winzigen Apartment im East Village und schlug sich recht und schlecht durchs Leben. Eine harte Zeit.
Zwischen Ginsberg und Warhol
Dokumentiert hat er sie in mehr als 10.000 Fotos. Rund 200 davon sind jetzt im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Die große Überraschung: Die Ausstellung ist so etwas wie ein Gesamtkunstwerk aus Ai Weiweis Gedanken und Ideen - auf den ersten Blick wie zufällig und doch hoch politisch und brisant.
1983 bis 1993 war Ai Weiwei ein Nobody, bekannt nur in der chinesischen Künstlergemeinde von New York. Niemand konnte ahnen, dass er 28 Jahre später ein bedeutender Kunst-Rebell sein würde, ängstlich beäugt und schließlich verhaftet von der chinesischen Regierung. Verehrt, bewundert und unterstützt von Menschen in der ganzen Welt. Das britische Magazin "Art Review" hat ihn gerade auf Platz eins der Liste der einflussreichsten Künstler gesetzt.
Damals, in New York, trafen sich junge Maler, Schriftsteller und Musiker in seinem Apartment in der Lower East Side, alle arm und hungrig nach dem Leben in der brodelnden Stadt. Ai Weiwei schlug sich mit Jobs durch: renovierte Wohnungen, putzte, arbeitete auf Baustellen, mähte Rasen und hütete Kinder. Frei fühlte er sich, so weit weg von China, aber auch einsam, denn alles war anders, als er es sich zu Hause ausgemalt hatte. "Ich war überrascht, dass Amerika als zivilisierte Gesellschaft bezeichnet wurde", sagte der Künstler später einmal in einem Interview. "Es ist ganz und gar nicht zivilisiert."
"Bitte helfen Sie"
Er fotografierte Straßenschlachten im Tompkins Square Park und Polizisten, die den Tumult misstrauisch beäugten und dann losschlugen, bis Blut floss. Er beobachtet Bill Clinton im Wahlkampf, wie er Hände schüttelte, bewacht von Bodygards. Transvestiten beim Wigstock-Festival, Obdachlose in der U-Bahn und einen jungen Schwarzen mit Schild um den Hals: "Ich habe Aids. Bitte helfen Sie". Schuhputzer und ihre arroganten Kunden im World Trade Center. Hunde, die durch ein verwahrlostes Haus an der Lower East Side streifen - heute unter Garantie luxussaniert.
Ai Weiweis Kunst war immer politisch: 1001 Chinesen lud er 2007 zur documenta nach Kassel ein. Er ließ antike chinesische Vasen zerbersten oder Sonnenblumenkerne aus Porzellan formen - Symbol für die Masse der Chinesen, die treu und ergeben der "Sonne" Mao dienten.
Verlorene Welt
Auf den New-York-Fotos ist Ai Weiwei auch immer wieder selbst zu sehen, stets mit ernstem Blick, aber trotzdem oft selbstironisch und komisch. Im Ringelhemd nach Picasso-Art auf seinem Bett sitzend, beim Billiard, beim Kartenspiel, im Waschsalon und mit einem Warhol-Porträt im Museum of Modern Art. In der U-Bahn-Station Union Square posiert er im Trenchcoat, cool wie ein französischer Krimi-Kommissar. Selbstbewusst sieht er da aus, stolz und sich seiner Sache sicher. Schon damals muss er geahnt haben, dass er stark sein muss, wenn aus ihm ein großer Künstler werden soll.
Seine Fotos, die wie flüchtige Schnappschüsse wirken, bilden heute eine verlorene Welt ab. Dieses New York gibt es nicht mehr. Und diesen jungen, hungrigen und unerschrockenen Ai Weiwei auch nicht.
Ai Weiwei in New York - Fotografien 1983-1993.
Martin-Gropius-Bau, Berlin
15. Oktober 2011 bis 18. März 2012