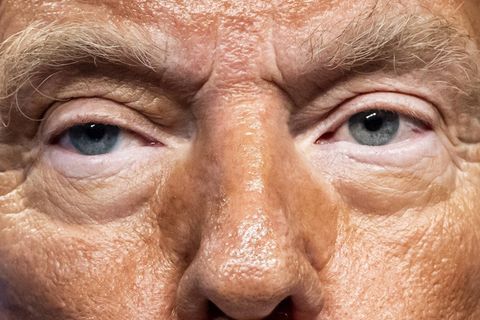Als junger Mann spielte Marcel van Eeden Bass in einer Betriebsfest-Combo, die mit Cover-Versionen von Hits ihr Geld verdiente. Jeden Abend trat er in niederländischen Zelten und Brauhäusern auf, bis er eine Freundin fand. Die stellte ihn vor die Alternative: die Band oder ich. Van Eeden entschied sich für die Frau. Von Cover-Versionen konnte er trotzdem nicht lassen. Allerdings nicht im musikalischen Feld, sondern im geschichtlichen - und zwar mit dem Bleistift.
Auf mittlerweile rund 5000 Blättern hat van Eeden Fotos abgezeichnet, die er in Zeitschriften, Büchern, Alben gefunden und auch von Internet-Standbildern abfotografiert hat. Einzige Bedingung: Sie müssen vor dem 22. November 1965 entstanden sein, seinem Geburtstag. Seit 1993 zeichnet der in Den Haag geborene Künstler jeden Tag mindestens ein Blatt der Vergangenheit. Seit 2001 stellt er die Bilder danach sofort ins Netz.
Marcel von Eeden im art-Magazin
Neben dem Porträt über Marcel von Eeden finden sind Berichte über den deutschen Messemarathon des Frühjahrs, über Kunst als Geldanlage und das Privatmuseum der Kunstsammlerin Julia Stoschek in art - Das Kunstmagazin
Vieles in Marcel van Eedens Welt ist klein. Die Formate (stets 19 mal 28 Zentimeter), das Salär (1600 Euro pro Blatt, davon die Hälfte für die Galerie). Er selbst ist auch kein Riese, und die Berliner Hinterhofwohnung, in der er arbeitet, ist geradezu winzig. Sein Bilderfundus dagegen ist riesig. Ihn interessiere alles - wobei aber nicht jedes Motiv aufgenommen werde. Er vermeidet es zum Beispiel, berühmte Abbildungen oder Personen der Zeitgeschichte zu zeichnen. New York etwa hält Marcel van Eeden für ein Klischee und deswegen für ein Motiv ohne Erzählung.
Pistolen, Gurken und skurrile Folk-Motive
"Am liebsten verwende ich Fotos von Geschichten und Menschen, die vergessen sind", erzählt van Eeden. Er wählt architektonische Ansichten, Landschaften, Stadtpanoramen, aber auch Menschen in unspektakulären Situationen. Dazwischen streut er immer wieder Darstellungen von Katastrophen, und Krieg. Einzelobjekte wie Pistolen oder Gurken finden ebenso Eingang wie skurrile Motive von folkloristischen Bräuchen. Aus diesen Einzelgliedern flicht van Eeden eine lange Kette atmosphärischer Eindrücke, mit der er sich ein Vorleben erfindet, das es so niemals gab.Marcel van Eedens künstlerisches Konzept basiert auf der Idee, den Tod durch eine neue Vergangenheit zu besiegen. Seit 1993 entsteht jeden Tag ein Stück fremde Vergangenheit, die er sich über ein Gefühl von Sympathie als seine aneignet.
Der Kurator einer Ausstellung in Den Haag hatte für van Eedens Arbeit mal den Begriff „Enzyklopädie des Todes“ geprägt. Doch der Künstler empfindet die Metapher längst als lästig: „Ich will nicht, dass die Arbeit eine solche Schwere bekommt.“ Trotzdem fasziniert ihn die Frage, warum der Mensch so viel Angst vor dem Tod hat. „Aber ich selbst bin überhaupt kein depressiver Mensch“, erklärt van Eeden mit Bestimmtheit. Und seine Bildfolgen sind es trotz des Todesthemas und der oft tiefen Schwärze seines Stils ebenso wenig.
Die Geschichte eines Mannes, der Elizabeth Taylor heiratet
In der Serie "K. M. Wiegand - Life and Work", die van Eeden im Sommer 2006 auf der Berlin-Biennale ausstellte und die ihm den künstlerischen Durchbruch verschaffte, konstruiert er eine abstruse Hochstaplergeschichte von großem Humor: Auf 139 Blättern erzählt er in scheinbar zusammenhangslosen Einzelszenen die Geschichte eines Mannes, der Elizabeth Taylor heiratet, eine Pazifikflotte befehligt, ein großer Künstler und ein großer Verbrecher ist, Staatsmänner interviewt und Warenhäuser entwirft, professionell boxt, taucht und Motorradrennen fährt. Dieser Tausendsassa der Moderne markiert auch in van Eedens Werk eine Zäsur, denn seit "K. M. Wiegand" strukturiert er seine Blätter zu Zyklen, die er mit Text klammert.
Sein bisher reifstes Werk, die große Bildfolge "Celia", benutzt für diese erzählerische Bindung vier Texte; darunter Robert Walsers "Spaziergang" und T. S. Eliots "Cocktailparty". Zwar regiert auch bei dieser Arbeit der Zufall, den van Eeden als Hoheitsregel über Auswahl und Kombination seiner Motive stellt. Denn die Zeichnungen zu dem Zyklus entstanden alle ohne Text, der erst später mit einer Schreibschablone in die Weißräume der Blätter geschrieben wurde. Es besteht an keiner Stelle eine Text-Bild-Verbindung. Der erstaunliche Effekt ist, dass es trotzdem meist einen scheinbaren, lyrischen Zusammenhang gibt.
Die Verbindung von Bild und Text
"Der Mensch sucht immer automatisch eine Verbindung zwischen Bildebene und Textebene, deswegen findet er sie auch", meint van Eeden. Und genauso sucht man in der jahrelangen Abfolge von Zeichnungen eine Geschichte - und findet auch diese. Vergleichbar mit der Écriture automatique - dem automatischen Schreiben - der Surrealisten überlässt er im Rahmen seiner strengen Methode der Intuition, dem Unbewussten die Führung.
Reise in arabische und vorderasisatische Länder
Den nächsten Zyklus von 200 Blättern, "Der Archäologe - die Reisen des Oswald Sollmann", der im Juni in Tübingen präsentiert wird, entwickelt van Eeden auf der Grundlage einer vorformulierten Biografie. Der Wissenschaftler Sollmann zieht - wie van Eeden selbst - von Den Haag nach Berlin und reist in die arabischen und vorderasiatischen Länder.
Freiheit ohne Beliebigkeit
Seinen Grundregeln möchte der obsessive Zeichner bis an sein Lebensende treu bleiben. "Mein Konzept wirkt auf den ersten Blick wie eine Beschränkung, aber es gewährt mir unglaubliche Freiheiten. Gleichzeitig bewahrt es mich vor der Beliebigkeit", sagt van Eeden. Dazu gehört auch, dass er seine Theorie nicht orthodox begreift. Es gibt mittlerweile schon mal Tage, an denen kein Bild entsteht, Farbe schleicht sich in den schwarzweißen Kanon ein, und das Ende von "Celia" ist auch nicht zufällig gewählt. Zu Walsers Worten "spät, und alles war dunkel" hat van Eeden die Nachtansicht einer Stadt gezeichnet.
Aber die Kunst einer guten Coverversion ist es ja gerade, nicht pedantisch das Notat abzuspielen, sondern in der Interpretation das Alte wie etwas Neues klingen zu lassen. Und das gelingt Marcel van Eeden mit seinen orphischen Zeichnungen so inspirierend, dass man immer neue Coverversionen seiner künstlichen Vergangenheit sehen will. Und das soll tatsächlich möglich sein bis zu seinem Tod: auf www.marcelvaneeden.nl.
Ausstellungen: "Celia", 28. April bis 16. Juni,
Galerie Michael Zink, Berlin; "Der Archäologe", 16. Juni bis 26. August, Kunsthalle Tübingen.
Literatur: "Celia", Hatje Cantz Verlag, 2006, 23 Euro.
"K. M. Wiegand. Life and Work", Hatje Cantz Verlag, 2006, 24,80 Euro. Galerie: www.galeriezink.de