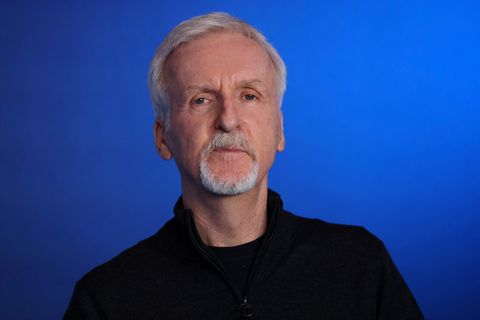Es entsteht jetzt - in diesem Moment - eine Welt. Sie verändert sich jede Sekunde, wächst unaufhörlich. Jeder kann sie bereisen, der einen Computer und eine Internetverbindung hat. Sie heißt "Second Life" und wurde vor vier Jahren von der kalifornischen Softwarefirma "Linden Lab" gegründet. Knapp fünf Millionen Menschen aus aller Welt leben hier bereits ein zweites Leben. Sie bewegen sich in dem virtuellen, dreidimensionalen Raum mit einem so genannten Avatar, einem digitalen Stellvertreter auf dem Monitor.
"Second Life" scheint wie für Kunst geschaffen: Alles, was hier existiert - jede Figur, jeder Baum, jedes Haus - wird von den Bewohnern erdacht und mit ein paar Mausklicks in die Welt gesetzt. Die Avatare können ihre Umgebung - und sich selbst - völlig frei gestalten, und das beginnt schon bei den Namen. Die meisten klingen exotisch, ein wenig sehnsüchtig, nach Filmstar oder Rocklegende: Nebulosus Severine, Filthy Fluno, Brian Hitchcock.
...gefunden im art-Magazin 05/07
Neben dem Bericht über Kunst in Second Life findet man im aktuellen art - Das Kunstmagazin ein Porträt über den derzeit angesagtesten deutschen Künstler Daniel Richter, über Gilbert & George, die konsequentesten Anzugträger der Kunstgeschichte und ein Interview mit Heiner Bastian, der sich mit großem Knall vom Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwart in Berlin, getrennt hat
Es gibt 100 "Dalis" und 64 "Rembrandts"
Ein Ort, der solch unbegrenzte Möglichkeiten bietet, zieht Kreative an, Künstler - oder solche, die es gern wären. Eine Suche in der Mitgliederliste ergibt, dass hier 64 "Rembrandts" leben, 100 "Dalís" und sechs, die gleich simpel und programmatisch "Kunst" genannt werden wollen. Und tatsächlich hat sich neben Inseln, Städten, Gärten, Discos und Bordellen auch eine vitale Kunstszene entwickelt mit Museen, Galerien, Malern, Bildhauern und Vernissagen. Theoretisch kann man als virtueller Künstler sogar reich werden, indem man seine Arbeiten an andere Avatare verkauft. "Second Life" hat eine eigene Währung, und jeder verdiente "Linden Dollar" kann in US-Dollar getauscht werden. Täglich geben Avatare mehr als eine Million echte Dollar aus, einen Teil davon auch für die digitale Kunst.
Tastatur und Maus statt Marmor und Meißel
Zum Beispiel für die Skulpturen von Cheen Pitney, im echten Leben ein gebürtiger Wiener, der schon seit langem in einer Kleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains lebt und seinen echten Namen nicht verrät. Nur so viel gibt er preis: "Im richtigen Leben bin ich kleiner, älter und kahler als die meisten." Hier ist er groß, athletisch und trägt eine dunkle Mähne. Er redet gern über seine Skulpturen, die überall hier stehen. "Einige davon, wie 'Der Glasbläser', sind nach Plastiken entstanden, die ich in den Rockys gebaut habe", sagt er, "aber die meisten sind nur hier möglich." Zum Beweis lässt er über seinem Studio, das hoch über den Wolken liegt, ein riesiges Einhorn im Himmel schweben. "Ich experimentiere hier mit völlig neuen Formen", sagt Cheen Pitney "und mit einer ganz neuen Art der Produktion." In der 3D-Welt im Internet gibt es keinen Marmor, keinen Meißel. "Ich habe nur Tastatur und Maus - das ist mein Werkzeug."
Wer es in große Häuser schafft, ist anerkannt
Es gibt Maler und Zeichner, Architekten und Designer, Videoinstallateure und Performancekünstler. Da sind Fotografen, die Bilder im "Second Life" machen und dort ausstellen, und Fotografen, die Fotos aus der realen Welt in der digitalen zeigen. Es ist fast wie im ersten Leben: Wer es in die großen Häuser schafft, ist anerkannt. Wer im "Second Louvre" hängt, der aussieht wie der echte Louvre, jedoch nichts mit dem Pariser Ausstellungshaus zu tun hat, der ist ein gemachter Avatar. Am Eingang steht eine archaische Skulptur mit Schild und Schwert. Sie heißt "Achilles - 2006" und stammt von Starax Statosky, dem ersten "Second Life"-Bildhauer. Aber ihn gibt es nicht mehr. "Er hat sich für immer ausgeloggt, weil er es nicht ertragen konnte, dass die Updates der System-Administratoren seine Werke zerstört hatten", erzählt Cheen Pitney. Offensichtlich hat auch diese junge Welt bereits ihre ersten Legenden.
Vom traditionellen Kunstbetrieb bislang noch kaum entdeckt, organisieren sich die Künstler selbst. Sie wohnen in Kolonien, bieten eine Kunsttour an, mit der jeder bequem durch die Szene reisen kann, sie organisieren Ausstellungen, hängen Plakate, laden zu Vernissagen. Zum Bespiel im großzügig angelegten "Ginsberg Arts Center", das Tommy Parrott betreibt. Im echten Leben hat er seinen Computerladen verkauft, um im "Second Life" Künstler auszustellen. Stockwerk über Stockwerk hängt hier Bild neben Bild. Anklänge an alle Epochen sind zu finden: Kubismus, Expressionismus, Realismus. Manche Werke sind naiv, einige unerträglich kitschig. Oft ist Tommy Parrott online, um die Gäste persönlich zu begrüßen und über Kunst zu reden. "Das ist meine größte Freude", sagt er "schließlich würden diese Gespräche ohne mein Arts Center nie stattfinden."
Londons hippste Galerie als frecher Namensklau
Zur Vernissage von Anett Lein kamen Avatare aus allen Teilen der Welt. Was der jungen Mainzer Künstlerin im realen Leben wohl kaum gelungen wäre, ist im "Second Life" kein Problem - ein Klick, und man ist da. Hier besitzt sie sogar eine eigene Galerie für ihre Gemälde, die "White Cube Gallery" - ein frecher Namensklau aus der realen Welt, wo sich Londons hippste Galerie so nennt. Für aufstrebende Maler wie Anett Lein bietet die virtuelle Kunstwelt eine Karrierechance, nicht nur weil sie digitale Abbilder ihrer Collagen verkaufen kann. Wenn ein Künstler hier vertreten ist, wird er automatisch Teil eines Netzwerks, wird diskutiert auf Websites und in Blogs und findet auf diese Weise womöglich auch Aufmerksamkeit in der echten Welt.
Die Grenzen werden ohnehin immer durchlässiger: Das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) plant für Oktober eine Dependance. Und ein "Second Life"-Kunstmagazin, "slart", gibt es auch schon. Noch dominieren da Themen wie "Von der Gitarre zur Groß-Skulptur". Aber bald schon könnte es um kompliziertere Inhalte gehen wie Plagiatsvorwürfe, Eigentums- und Urheberrechtsfragen. Oder um die Qualität und revolutionäre Kraft der virtuellen Kunst. Die wirkt nämlich mit ihren Einhörnern und Rittergestalten bislang kaum wie das Trainingslager einer ernst zu nehmenden Avantgarde. Es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis man sich auf einer "Second Life"-Kunsttour wie in Chelsea fühlt.