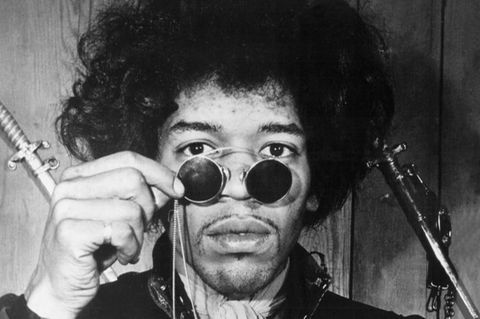Die Nachricht kam kurzfristig, und sie kam überraschend: Eigentlich wollte Ronja Maltzahn am Freitag bei der Klimademonstration in Hannover auftreten. Doch am Mittwoch sagte Organisator Fridays for Future der Sängerin ab.
Die Begründung: Es sei nicht mit dem "antikolonialistischen und antirassistischen Narrativ" vertretbar, "eine weiße Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne zu haben". Das sei "eine Form von kultureller Aneignung", heißt es in dem Ausladungsschreiben, das Maltzahn auf ihrem Instagram-Account geteilt hat. Denn Dreadlocks seien "in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung" genutzt worden. Deshalb sollten weiße Menschen, so das Statement von FFF Hannover, keine Dreadlocks tragen, "da sie sich einen Teil einer anderen Kultur aneignen, ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben".
Der Kern des Problems ist der Begriff der "kulturellen Aneignungen". Das Thema wird in der englischsprachigen Welt als "cultural apppropriation" schon länger diskutiert. Im Kern geht es bei der Debatte um die Frage: Sind Kulturen bestimmten Ethnien und Völkern zugeordnet - oder sind sie frei und jedem offen zugänglich.
"Kulturelle Aneignung" oder Wertschätzung?
Dahinter steht ein Konflikt, der unter dem Begriff Identitätspolitk immer wieder durchschimmert: Rechtsextreme Identitäre vertreten schon lange ein kulturelles "Reinheitsgebot". Aber auch das linke identitätspolitische Denken vertritt die Auffassung, dass nicht jede Kultur jedem offensteht. Demgegenüber befürwortet das liberale Modell gerade das Gegenteil: Eine radikale Mischung von Menschen, Stilen und Kulturen.
In den zurückliegenden Jahren wurden diese Debatten wiederholt geführt. Sie entzündete sich an Fragen wie: Dürfen weiße Menschen den Blues spielen? Kann ich noch Eminem hören? Und darf ich zum Mexikaner essen gehen, auch wenn er in Wahrheit Europäer ist? Und muss ich jetzt meine Rolling-Stones-Alben verbrennen?
Um die starren Fronten aufzulösen, gibt es seit einiger Zeit das Bemühen, begrifflich stärker zu differenzieren. Hierzu wird die Unterscheidung zwischen "cultural appropriation" und "cultural appretiation" eingeführt - also die Differenz zwischen Aneignung und Wertschätzung.
Ronja Maltzahn plädiert für Vielfalt und Toleranz
Demnach müsste man das Motiv des "Aneignenden" hinterfragen: Reflektiert er seine eigenen Kultur? Berücksichtigt er den Kontext der entlehnten Kultur? Und gibt er etwas zurück? Alles Fragen, die dazu geeignet sind, starre Grenzen aufzuweichen und einen Diskussionsprozess in Gang setzt.
Ronja Maltzahn jedenfalls, die musikalisch dem Genre Worldpop zugeordnet werden kann, bevorzugt es bunt und kosmopolitisch. Sie mischt verschiedene Stile und Kulturen munter durcheinander. Sie tritt mit 15 Musikern aus verschiedenen Nationen auf, das Ensemble singt auf sieben Sprachen, wie sie in einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte. Die Haltung der 28-Jährigen ist klar: Sie stehe für kulturelle Vielfalt und Toleranz. Und damit für das Gegenteil dessen, was ihr von Fridays for Future vorgeworfen wird.
Verwendete Quelle: Instagram, Greenheart.org