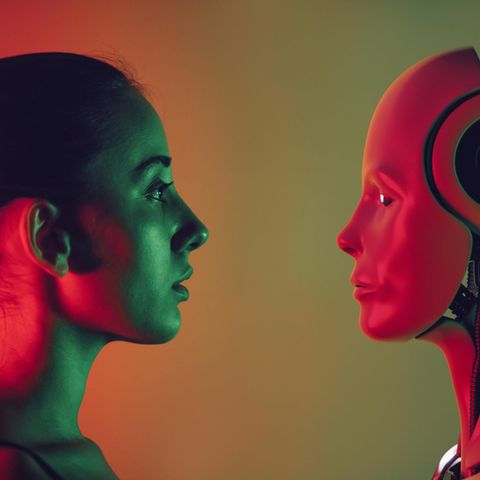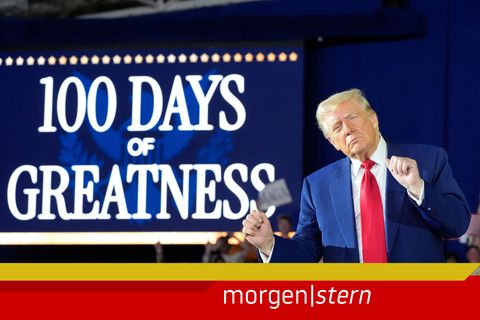Im Manchester Museum lagerte über 100 Jahre ein Fischkopf-Fossil, welches ursprünglich mal in einer Kohlemine in Lancashire gefunden wurde und im Jahr 1925 erstmals protokolliert wurde. Forschende der Universität von Michigan haben den Schädel des Fossils mit einem CT-Scan untersucht und sind dabei zufällig auf eine Sensation gestoßen: die Spuren eines Fisch-Gehirn-Fossils, das etwa 319 Millionen Jahre alt ist.
Das etwa 2,5 Zentimeter große Gehirn und die dazugehörigen Hirnnerven sollen von einem 20 Zentimeter großen, ausgestorbenen Blaukiemenfisch stammen. Der "Coccocephalus wildi" soll ein früherer Vertreter der Strahlenflosser sein. Heute sind sie eine Klasse der Knochenfische, die weltweit verbreitet ist – von der Tiefsee bis ins Hochgebirge.
Es handele sich um einen Zufallsfund
Eigentlich hatten die Wissenschaftler nicht erwartet, die Überreste eines Gehirns zu entdecken. Mit dem CT-Scan wollten sie lediglich Einblicke in die knöcherne Innenstruktur des Schädels nehmen. Die Forschenden entdeckten dabei, dass sich ein Objekt im Schädel abzeichnete. Bei späteren Untersuchungen wurde deutlich, dass es sich um ein gut erhaltenes Gehirn-Fossil handele.
Für gewöhnlich werden von Paläontologen Strukturen entdeckt, die hart sind, wie Knochen, Zähne oder Panzerungen, seltener Spuren organischen Gewebes. Das entdeckte Gehirn-Fossil war wohl so gut konserviert, weil der Fisch kurz nach seinem Tod in Sedimenten mit wenig Sauerstoff begraben wurde. Eine chemische Mikroumgebung im Schädel habe dabei geholfen, das Hirngewebe in Mineralien umzuwandeln – und schließlich zu erhalten.
Einer der Forschenden, der Paläontologe Matt Friedmann, erklärt in seinem Bericht, dass es "eine wichtige Entdeckung sei, dass auch diese Art von Weichteile konserviert werden können". Friedmanns Co-Autor und Kollege Rodrigo Figueroa, fügt hinzu, "dass das Gehirn-Fossil nicht nur eine besondere Kuriosität sei, sondern einen erheblichen Wert für das Verständnis von Mustern der Gehirnevolution besitzt". Anders als bei heutigen Wirbeltieren habe sich bei der Embryonalentwicklung das Gewebe des Gehirns nach innen gefaltet. Diese Entdeckung könne künftig dabei helfen, die heutigen Rochenflossenfische besser zu verstehen, erklären die Forschenden auf der Webseite der Universität.
Quellen: "Universität Michigan", "BBC", "Bild der Wissenschaft"